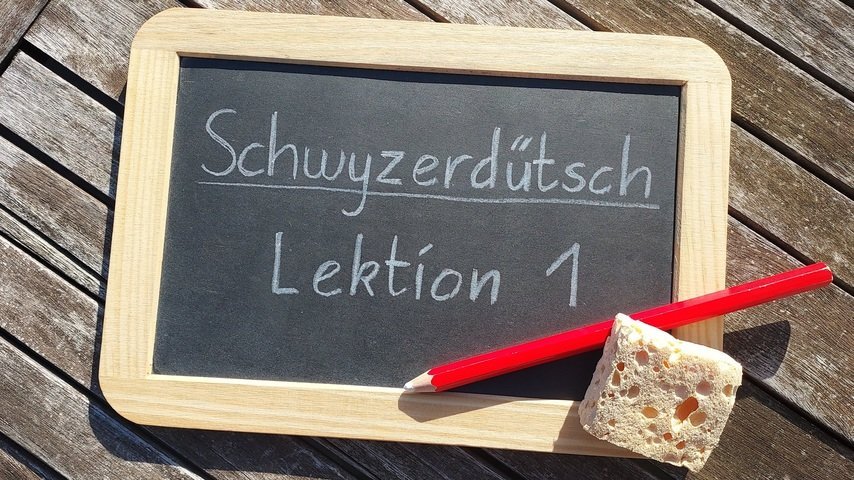Das Eidgenössische Schwingfest

Pratteln im Kanton Basel-Land, Ende August 2022. Zwei Monate lang wurde hier eine gigantische Zeltstadt auf einem Acker errichtet. Drei Tage lang Menschen in Trachten und Schweizerfahnen wohin man auch blickt. Eine Festwiese mit Bühne, bespielt von Jodlerclubs und Schwyzerörgeliorchester, Schlager- und Popstars. Vorausgesetzt, sie sind Schweizer und singen Schweizer Mundart. Wer hier denkt, mehr „typisch Schweiz“ ginge nicht, wird sich zwangsläufig noch wundern. Etwa 750 Meter Hauptverkehrsstraße wurden gesperrt, um hier Imbissbuden und Marktstände aufzustellen. „Schwiizer Chuchi“, „Swiss Chalet“ und „Cordon Bleu“ stechen sofort hervor. Bei einem zünftigen Schweizer Volksfest müssen Klassiker, wie Raclette, Cervelas und Älplermagronen grundsätzlich verfügbar sein. Doch während man hin und her überlegt, um sich für eins davon entscheiden zu können, schweift der Blick über die anderen Buden davon: Bratwurst, Schüblig mit Senf, Knobi-Brot, Nackensteaks mit Hörnlinudeln, Hörnli mit gehacktem, Hörnli mit Käsefondue im Fladenbrot, Pizza, Pasta, Burger, Pommes, halbes Güggeli (Hähnchen), Crèpes, Softeis, Steinpilzrisotto mit Tomaten und Rucola, indische Speisen, japanische, chinesische… Hilfe! Die Magenüberdehnung ist wohl unvermeidbar. Aber vielleicht hilft anschließend ja ein „Kafi Lutz“. Der darf nämlich auch niemals fehlen. Ein Kaffee mit Zucker und einem Schuss Obstbrand.
Bei so viel Essen, Gejodel und Fahnenschwingerei vergisst man beinahe, worum es bei diesem gewaltigen Fest überhaupt geht.
Inmitten des Festgeländes thront das größte mobile Stadion der Welt. Sechs überdachte Tribünen bieten Platz für 50.900 Zuschauer. Das sind drei mal so viele, wie Pratteln Einwohner hat. Doch nur 4500 Tickets sind im freien Verkauf für 115 bis 265 Franken erhältlich. Die übrigen Plätze werden an Sponsoren und Vereine verteilt. In das Stadion zu kommen, ist aber nicht zwingend nötig. Auf dem Festgelände sind Großleinwände verteilt, auf denen man live das Geschehen auf den 14.000 Quadratmetern Rasenfläche in der Arena verfolgen kann.
Die Nationalhymne wird gespielt und 51.000 Menschen singen stolz mit. Auf dem Rasen sieht man sieben sauber verteilte Kreisflächen aus Sägemehl. Zwei hünenhafte Männer, meist in Trachtenhemden gekleidet, mit einer Art „Windel“ aus Leinen über der normalen Hose, stapfen ins Sägemehl und stehen sich zunächst gegenüber. Auf das Signal eines Schiedsrichters beginnen sie nun, sich merkwürdig ineinander zu verhaken und gegenseitig an den „Windeln“ zu rütteln. Wenige Augenblicke später gehen plötzlich beide zu Boden und wälzen sich im Sägemehl. Die Arena tobt. Derjenige, der unten lag, mit dem Rücken im Sägemehl, hat wohl verloren. Der andere hilft ihm respektvoll auf und wischt ihm mit den Händen das Mehl vom Rücken. Der Sieger des Turniers wird als „König“ bezeichnet und bekommt zunächst einen Kranz und eine große, verzierte Kuhglocke. Der Hauptgewinn: Ein stattlicher Stier. Geld gibt es nicht zu gewinnen, es sei denn, man verkauft den Stier. Die übrigen Gewinner dürfen sich aus einem „Gabentempel“ einen Preis aussuchen, der von Sponsoren gestiftet wurde. Motorroller, Rasentraktoren, kunstvoll geschreinerte Betten, Schränke, Küchenmöbel und was sonst so gestiftet wird. Die besten Kämpfer des Landes werden „die Bösen“ genannt.
 Was hier auf den ersten Blick für Nicht-Schweizer möglicherweise befremdlich und lustig klingen mag, hat allerdings eine jahrhundertealte Tradition und verdient höchsten Respekt. „Schwingen“ nennt man diesen typisch schweizerischen Volkssport. Ursprünglich als Sport der Bauern und Hirten entstanden, wird das Schwingen auch heute noch ausschließlich von Amateuren betrieben, die neben ihren eigentlichen Berufen ihre Körper mit äußerster Disziplin für Wettkämpfe trainieren. Die Verletzungsgefahr beim Schwingen ist, trotz Sägemehl, extrem hoch. Nicht selten werden Schwingerkarrieren durch Verletzungspech urplötzlich beendet.
Was hier auf den ersten Blick für Nicht-Schweizer möglicherweise befremdlich und lustig klingen mag, hat allerdings eine jahrhundertealte Tradition und verdient höchsten Respekt. „Schwingen“ nennt man diesen typisch schweizerischen Volkssport. Ursprünglich als Sport der Bauern und Hirten entstanden, wird das Schwingen auch heute noch ausschließlich von Amateuren betrieben, die neben ihren eigentlichen Berufen ihre Körper mit äußerster Disziplin für Wettkämpfe trainieren. Die Verletzungsgefahr beim Schwingen ist, trotz Sägemehl, extrem hoch. Nicht selten werden Schwingerkarrieren durch Verletzungspech urplötzlich beendet.
Diesen Sport zu belächeln, ist also alles andere, als angebracht. Oft kommen erst in Zeitlupenwiederholungen die enorme Kraft und Geschwindigkeit zum Vorschein, mit denen die Schwinger aufeinander losgehen, oder im Bruchteil einer letzten Sekunde durch geschickte, fast schon unmögliche Bewegungen, die sicher geglaubte Niederlage abwenden können und am Ende auch noch durch schnelle Konter den Kampf gewinnen.
Im Gegensatz zu beispielsweise Boxkämpfen, wo aggressive Rivalitäten und Kampfhahngehabe schon im Vorfeld des Kampfes quasi zur Show gehören, wird man beim Schwingen beeindruckt sein, mit welcher Fairness die Kontrahenten einander begegnen. Dass der Sieger dem Verlierer das Sägemehl vom Rücken wischt, ist eine obligatorische Geste, wie bei asiatischen Kampfsportarten die Verbeugungen vor und nach dem Kampf. Nicht selten kommt es aber auch vor, dass sich beide am Ende des Kampfes in den Armen liegen und gegenseitig zum Sieg gratulieren, beziehungsweise über die Niederlage trösten. Böses Blut wird man im Schwingsport nicht finden.
Der Ursprung des Schwingens lässt sich nicht genau datieren. Die älteste bekannte Darstellung eines Schwingfestes deutet auf einen möglichen Ursprung im 13. Jahrhundert hin. Bereits zu dieser Zeit waren Schwingkämpfe keine reinen Sportwettbewerbe, sondern von einem geselligen Festcharakter geprägt. 1805 bekam das Schwingen den Stempel „typisch Schweiz“. In Urspunnen bei Interlaken im Kanton Bern veranstaltete man ein Sportfest mit drei original Schweizer Sportarten. Als Hauptwettbewerb das Schwingen, außerdem das Hornussen und das Steinstossen. Das Organisationskomitee erklärte als ausdrückliches Ziel des Festes, die „Hebung des schweizerischen Nationalbewusstseins“. Eine ähnliche Wirkung schreibt man heute beispielsweise internationalen Fußballmeisterschaften zu.
1895 gründete sich schließlich der Eidgenössische Schwingverband mit schweizweit einheitlichen Reglementen. Noch im selben Jahr feierte man am 18. August das erste Eidgenössische Schwingfest in Biel, Kanton Bern und beschloss, es alle drei Jahre an einem anderen Ort zu veranstalten. Im Eidgenössischen Schwingverband sind die fünf großen, kantonsübergreifenden Regionalverbände vereint. Etwa 50.000 Mitglieder zählen heute dazu. Männer wie Frauen. Sogar bei Kindern erfreut sich das Schwingen großer Beliebtheit.
Bis in die 1970er Jahre war das Schwingen eine reine Männerdomäne und Frauen grundsätzlich davon ausgeschlossen. Nationalistische Strömungen durchzogen sämtliche Verbände von den Kämpfern und deren Betreuen bis zu den obersten Funktionären. Seither hat sich jedoch das gesellschaftliche Verständnis von „schweizerischem Nationalbewusstsein“ deutlich geändert.
Während damals noch vor allem die national-konservativen das Schwingen für sich als Werbeplattform pachteten, ist das Schwingfest, wie man es heute kennt, ein Volksfest im allerbesten Sinne. Ein Fest für das ganze Volk. Selbst linke Politiker besuchen heute Schwingfeste und halten dort Ansprachen. Alle Schichten und alle Altersklassen der Gesellschaft gehen heute ans Schwingfest, oder verfolgen es im Schweizer Fernsehen. Kantönligeist, Reibereien und Rivalitäten lässt man hier ruhen und besinnt sich auf die Gemeinsamkeiten.
Wie auf dem Rütli einst geschworen, findet man hier „ein einig Volk von Brüdern“ (...und Schwestern), das die Schweiz und ihre Kultur friedlich und offenherzig feiert und an nichts und niemandem etwas auszusetzen hat, außer vielleicht an den Fehlentscheiden der Ringrichter, oder am Garpunkt der Älplermagronen.
Das nächste Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) - so die offizielle Bezeichnung - wird Ende August 2025 im Glarnerland zelebriert.