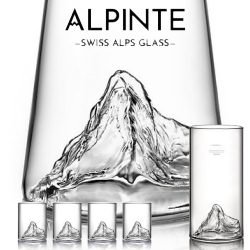Schießsport in der Schweiz – mehr als nur ein Hobby

Die Schweiz ist ein Land der Berge, der Neutralität – und der Schützen. Die Legende von Wilhelm Tell mit seiner Armbrust versinnbildlicht bis heute die uralte Schützentradition und den Schießsport, die tief in der Geschichte, der Gesellschaft und der Identität des Landes verankert sind. Ihre Traditionen reichen zurück bis in die Anfänge der Eidgenossenschaft, als die zahlenmäßig deutlich unterlegenen Schwyzer anno 1315 die Habsburger in der Schlacht am Morgarten in die Flucht schlugen. Im Jahr 1824 wurde schließlich der «Schweizerische Schützenverein» gegründet, der nicht nur den Beginn einer institutionalisierten Schützenbewegung markierte, sondern auch den Weg zur Gründung des heutigen «Schweizer Schießsportverbands» («SSV») ebnete.
Die Schützen und das Militär – Tradition und Wehrfähigkeit
Der Schießsport in der Schweiz verdankt seinen heutigen Stellenwert nicht zuletzt der engen Verknüpfung mit der Landesverteidigung. Seit 1874 besteht für Angehörige der Armee die Pflicht, außerdienstliche Schießübungen zu absolvieren. Ziel war es damals - und ist es bis heute - die Wehrfähigkeit der Bevölkerung zu erhalten und zu fördern. Anlass für die Einführung dieser Pflicht war ein ernüchterndes Ergebnis im Schießtest innerhalb der Armee: Nur etwa 15 Prozent der Soldaten trafen ihr Ziel aus einer Distanz von 300 Metern. Als Reaktion darauf wurde die bis heute geltende militärische Schießpflicht eingeführt. Jeder Schießpflichtige muss seine Übung bis spätestens zum 1. August eines jeden Jahres absolviert haben.
Die Verantwortung und Durchführung der Schießübungen obliegt allerdings nicht der Armee. Stattdessen wird das Eidgenössische Feldschießen vom SSV, dem Schweizer Schießsportverband, ausgerichtet. Dieser eint auch die einzelnen Schützenvereine der Schweiz und ist der Träger des Eidgenössischen Schützenfestes. Der enge Bezug der Schweizer Schützen zum Militär unterscheidet sie auch grundlegend von anderen Ländern, etwa Deutschland, wo der Gedanke der Wehrfähigkeit längst keine tragende Rolle mehr spielt. In der Schweiz hingegen ist die Verbindung zwischen Bürger, Waffe und Landesverteidigung nach wie vor mehrheitlich akzeptiert und respektiert und damit lebendig. Besonders Anlässe mit historischem Hintergrund, wie das traditionelle Morgartenschießen sollen diese Verbindung stärken. Der Sieger dieses Wettkampfes gewinnt sogar ein neues Sturmgewehr 90.



Das Eidgenössische Feldschießen – Wo Sportschützen und Militär sich begegnen
Aus dieser besonderen Verbindung zwischen Tradition, Gesellschaft und Militär entwickelte sich das Eidgenössische Feldschießen (EFS), eine einzigartige Veranstaltung, die seit 1940 jährlich stattfindet. Anders als das alle fünf Jahre durchgeführte Eidgenössische Schützenfest ist das Feldschießen dezentral organisiert. Die Teilnehmer suchen jeweils einen bestimmten Schießstand in der Nähe ihres Heimatortes auf und schießen ausschließlich mit den Ordonnanzwaffen der Schweizer Armee. Es ist die größte Schießsportveranstaltung der Welt, bei der 2025 bereits am Hauptwochenende über 111.000 Schützen teilgenommen haben. Dabei steht, zumindest für Schützen und Zivilisten, nicht der Rang im Mittelpunkt: Ganz im Sinne des Mottos: «Teilnahme kommt vor dem Rang».
Das EFS ist offen für alle Interessierten, auch für jene, die keinem Schützenverein oder der Armee angehören. Einzige Voraussetzung: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen im Wettkampfjahr das 10. Lebensjahr erreichen. Diese Offenheit macht das Feldschießen zu einem echten Volksanlass mit großer gesellschaftlicher Breitenwirkung. Die Vorgaben für die Übungen sind streng, und dennoch erzielen rund 60% der Teilnehmenden ein Kranzresultat, was die hohe Qualität des Schweizer Schießsports belegt.



Das Eidgenössische Schützenfest
Alle fünf Jahre verwandelt sich eine Schweizer Stadt in das Zentrum der Schützenwelt: Das Eidgenössische Schützenfest ist das größte Schützenfest der Welt, gemessen an den teilnehmenden Schützen. Es vereint rund 50.000 aktive Schützen sowie hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist nicht nur ein sportlicher Anlass, sondern auch ein gesellschaftliches Großereignis mit Festumzügen, musikalischer Unterhaltung, Gottesdiensten und Ansprachen von Bundesräten. Auch hier wird die Tradition der Gemeinschaft gepflegt. Meist kommen sogar mehr Gäste als aktive Schützen.
Am Eidgenössischen Schützenfest 2020 in Luzern (durchgeführt im Jahr 2021) war das sogenannte «Schützendorf» ein besonderes Highlight mit Verpflegungsständen, Restaurants, einer Armee-Ausstellung und sogar einem Public-Viewing-Platz für die Fußball-EM. Der Aufwand hinter einem solchen Fest ist enorm: Rund 5.000 Helfer leisten über 150.000 Arbeitsstunden. Organisiert wird das Fest von einem lokalen Organisationskomitee. Das nächste, 59. Eidgenössische Schützenfest findet 2026 in Chur statt.
 Der Schweizer Schießsportverband – So eint man Schützen
Der Schweizer Schießsportverband – So eint man Schützen
Die Organisation hinter all diesen Anlässen ist der Schweizer Schießsportverband (SSV), der heute mit rund 130.000 Mitgliedern der viertgrößte Sportverband der Schweiz ist. Über 58.000 von ihnen sind lizenziert und nehmen regelmäßig an nationalen Wettkämpfen teil. Viele andere schießen aus Freude an der Tradition oder im Rahmen von Vereinsanlässen. Der SSV stellt sicher, dass der Schießsport als Freizeit- und Leistungssport gleichermassen gefördert wird. Dazu trägt auch das Nationale Leistungszentrum in Magglingen bei, das 2016 eröffnet wurde.
Um den Fortbestand der Schützentradition zu sichern, setzt der Verband besonders auf die Jugendförderung. Neben dem Feldschießen sind auch Anlässe wie das Knabenschießen in Zürich wichtige Pfeiler dieser Strategie. Trotz aller sportlichen und militärischen Aspekte steht die Gemeinschaft im Zentrum der Schweizer Schützentradition. Viele Schützenvereine der Schweiz pflegen auch abseits der Schießstände engen Kontakt. Sie unternehmen gemeinsame Ausflüge, treffen sich in der Beiz zum Jass, oder organisieren gar ein Freundschafts-Eishockey-Match gegen Profi-Vereine für einen Spaß und einen guten Zweck. Ob beim Feldschießen, beim großen Schützenfest oder beim Training im Verein – «Schütze ist man nie allein». Die gelebte Kameradschaft, das gemeinsame Feiern und das Gemeinschaftsgefühl machen den Schießsport in der Schweiz seit über 200 Jahren zu weit mehr als nur einem sportlichen Hobby.
 Ausflugstipp: Das Schweizer Schützenmuseum in Bern, das im November 2025 nach einjährigem Umbau neu eröffnet wird, führt interessierte tief in die Welt der Schweizer Schützentradition ein. An einem kleinen Schießstand können Besucher sich sogar selbst am Luftgewehr versuchen.
Ausflugstipp: Das Schweizer Schützenmuseum in Bern, das im November 2025 nach einjährigem Umbau neu eröffnet wird, führt interessierte tief in die Welt der Schweizer Schützentradition ein. An einem kleinen Schießstand können Besucher sich sogar selbst am Luftgewehr versuchen.