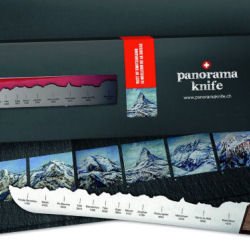Der Schweizer Nachthimmel - Wo sich die Sterne am besten beobachten lassen

Flatternde Fledermäuse, alles verschlingende Dunkelheit und sternenklarer Blick in unsere Galaxie – All das bekommen wir kaum noch zu Gesicht. Die Lichtverschmutzung beraubt uns an den meisten Orten des Anblicks unseres faszinierenden Nachthimmels. Besonders in Städten oder stadtnahen Gebieten ist «Light Pollution» besonders dramatisch. Diese eher unbekannte Art der Umweltverschmutzung hat sich über die letzten Jahre intensiviert und ist zu einem naturschutzrelevanten Problem avanciert. Lichtverschmutzung nimmt umfassenden Einfluss auf Arten und Lebensräume, somit auf die biologische Vielfalt und nicht zuletzt auch auf den Menschen. Wo Naturschutz vorherrscht, da finden wir auch die besten Orte, um den Sternenhimmel zu bewundern.
Die Schattenseite des Lichtes
Licht ist einer der bedeutendsten Faktoren für das Leben auf der Erde. Kein Wunder also, dass dessen Einfluss sich auf jedes lebende Wesen auf der Erde ausweitet. Unter Lichtverschmutzung versteht man die erhöhte Lichtemission durch den Menschen und die daraus resultierende Aufhellung unseres Nachthimmels. In den letzten Jahren hat sich die anthropologische Lichtemission stark erhöht – mit weitreichenden Folgen für uns Menschen und die Natur.
Unsere «Circadiane Rhythmik», also der 24-Stunden Rhythmus unseres Körpers, wird maßgeblich durch den Tag-Nacht-Wechsel mitbestimmt. Lichtintensität und Farbe nehmen Einfluss auf unsere «Innere Uhr» und unsere Hormone. Maßgeblichen Einfluss auf unseren Schlaf hat das uns umgebende Licht. In einem natürlichen Rhythmus signalisiert der Sonnenuntergang unserem Körper durch die abnehmende Lichtintensität und den steigenden Rotanteil im Licht, dass es Zeit wird zu schlafen. Unser Gehirn registriert diese Veränderung und schüttet das Hormon Melatonin aus, welches uns schläfrig macht. Geht die Sonne wieder auf, wird die Lichtintensität zunehmend stärker und der Blauanteil wird erhöht. Dieser signalisiert unserem Körper dann, dass es an der Zeit ist, wieder wach zu werden. Künstliches, kaltweißes Licht mit hohem Blaulichtanteil, wie zum Beispiel Handydisplays und Monitore ausstrahlen, manipuliert unseren Tag-Nacht-Rhythmus und vermindert unsere Schlafqualität.
 Auch auf die Pflanzenwelt nimmt überschüssiges Licht großen Einfluss, indem es den Saisonrhythmus stört. Äste ein und derselben Pflanze treiben früher aus, wenn sie unter ständiger Beleuchtung stehen als jene, die unter dem Einfluss natürlicher Beleuchtung stehen. Zusätzlich ziehen dauerbeleuchtete Äste ihren Saft erst später im Jahr zurück als natürlich beleuchtete. Das macht sie verletzlicher in Kältemonaten und stellt ein Risiko für ihr Überleben dar.
Auch auf die Pflanzenwelt nimmt überschüssiges Licht großen Einfluss, indem es den Saisonrhythmus stört. Äste ein und derselben Pflanze treiben früher aus, wenn sie unter ständiger Beleuchtung stehen als jene, die unter dem Einfluss natürlicher Beleuchtung stehen. Zusätzlich ziehen dauerbeleuchtete Äste ihren Saft erst später im Jahr zurück als natürlich beleuchtete. Das macht sie verletzlicher in Kältemonaten und stellt ein Risiko für ihr Überleben dar.
Gleichermaßen von zu viel Licht betroffen sind Zugvögel. Den Großteil ihrer Strecke legen die Tiere nachts zurück, sie orientieren sich dabei vorwiegend an den Sternen. Bei wetterbedingt schlechten Sichtverhältnissen können punktuell starke Lichtquellen oder Lichtglocken die Vögel ablenken und auf Umwege leiten. Dabei verlieren sie Energie, welche sie für die lange, kräftezerrende Reise so dringend benötigen, und verenden im schlimmsten Fall an Erschöpfung.
Auch die zahlreichen anderen nacht- und dämmerungsaktiven Tiere werden durch die Lichtverschmutzung in ihrer Lebensweise gestört, wie etwa die Fledermaus beim Jagen. Alle heimischen Fledermausarten in Europa ernähren sich ausschließlich von Insekten. Die Tiere sind vorwiegend in der Dämmerung oder eben ganz in der Nacht unterwegs, wenn auch die meisten Insekten wie Mücken, Motten und Käfer aktiv sind. Tagsüber suchen sie sich lichtgeschützte Räume als Schlafquartier. Werden Quartiere nachts von außen künstlich beleuchtet, fliegen sie oft sogar gar nicht aus und finden keine Nahrung. Zudem schneiden Lichtstraßen das Jagdrevier der Fledermäuse, was zu einer zunehmenden Verkleinerung des Raumes führt. Beides resultiert in einer schlechteren Nahrungsversorgung der Population und gefährdet als Folge auch die Nachkommenschaft und das Fortbestehen der Art. Laternen ziehen zwar Insekten an, bringen aber auch deren biologischen Rhytmus aus dem Gleichgewicht, sodass sie verenden.

Der Naturpark Gantrisch bei Nacht
Als einziger Ort der Schweiz trägt der Naturpark Gantrisch im Kanton Bern den Titel «International Dark Sky Park». Seit Anfang 2024 trägt der Park den Titel und verschreibt sich so der Verminderung der Lichtverschmutzung. Über 104 Quadratkilometer im Herzen des Parks sind zur Lichtschutzzone deklariert worden. Die sechs, in diesem Gebiet ansässigen, Gemeinden folgen einer strengen Reglementierung, um dieses internationale Label zuhalten. Während im Stadtgebiet Bern der Nachthimmel um ein 40-faches erhellt wird, so beträgt der Wert in der Lichtschutzzone des Naturparks gerade einmal 0,3 bis 2,5. Ganzjährig widmet sich der Naturpark Gantrisch dem Kampf gegen übermäßige Lichtverschmutzung.
Im Zuge dieser Bemühungen bietet der Park bis Mitte Oktober zahlreiche Vorträge, Exkursionen und auch Nachtwanderungen an. Hier heißt es nicht wie üblich Taschenlampe einpacken, sondern viel mehr Augen auf und Ohren spitzen. Für Gruppen, Schulklassen und Familien gibt es Tagsüber und in der Dämmerung ein breites Angebot rund um die Sterne, Lichtverschmutzung und das Leben in der Nacht. «Nur was man kennt und wertschätzt, das schützt man auch» - Mit diesem Leitsatz bemüht sich der Naturpark um Aufklärung, Bewusstsein und Veränderung.

So lässt sich der Sternenhimmel am besten beobachten
Wer mit bestem Blick die Sterne, Sternschnuppen, die Milchstraße, Satelliten und so weiter beobachten möchte, muss nicht unbedingt in den Naturpark Gantrisch reisen. Auch sehr viele andere Orte in der Schweiz bieten beste Bedingungen dazu. Die Aletsch-Region im Oberwallis mit ihren kleinen Bergdörfern auf 2.000 Metern Höhe, wo nur kleinere Ortschaften im Tal den Nachthimmel beleuchten, gilt beispielsweise als Hotspot für Astrofans. Ebenso das Engadin, die Surselva und das Val Mustair in Graubünden.
1. Die richtige Uhrzeit wählen
Vorab einen Blick auf die Uhrzeit des Sonnenuntergangs zu werfen ist grundsätzlich ratsam. Für eine Wanderung mit Kindern empfiehlt es sich, die Herbst- oder Wintermonate zu wählen, da es hier bereits früher dunkel wird und die Bettzeit der Kinder problemlos eingehalten werden kann. Rund zwei Stunden nach Sonnenuntergang sind alle drei Dämmerungsstufen durchlaufen, bis auch der letzte Lichtstrahl von der Dunkelheit verschluckt wird. Bei einer Nachtwanderung empfiehlt sich eine Taschenlampe mit rotem Licht. Damit gewöhnen sich die Augen viel schneller an die Dunkelheit.

2. Dunkle Ecken finden
Um die Sterne und unsere Galaxie richtig zu sehen, bedarf es logischerweise Dunkelheit. Mithilfe einer «Light Pollution Map» können passende Orte gefunden werden. Je dunkler die Farbe auf der Karte, desto weniger Lichtverschmutzung. Ab Stufe Grün ist die Milchstraße im Normalfall gut zu sehen.

3. Sich über den Mondgang informieren
So schön der Mond auch sein mag, für einen Spaziergang mit dem Ziel, die Sterne zu begutachten, ist er leider ein Störfaktor. Je voller der Mond, desto heller reflektiert er das Licht der Sonne und erhellt den Abendhimmel. Neumond oder der Mondaufgang versprechen einen dunklen Nachthimmel. Ein Blick auf die Mondphasen ist hilfreich.

4. Die Milchstraße und Sternbilder
Das Highlight sind natürlich die Sterne. Zur richtigen Jahreszeit ist sogar die Milchstraße mit bloßem Auge gut zu erkennen. Von Juni bis August ist die Milchstraße quasi die ganze Nacht zu sehen, im September und Oktober am ehesten nach der Dämmerung. Grundsätzlich ist die Milchstraße in Richtung Süden sichtbar. Wer gerne die Sternbilder am Himmel identifizieren möchte, kann sich ein schönes Plätzchen suchen und verruchen, die Sternbilder ohne Hilfsmittel zu identifizieren oder Apps oder Bücher zur Hilfe nehmen.