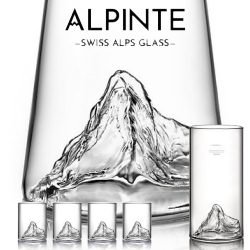Henry Dunant und sein Kampf für Menschlichkeit

Von den Genfer Konventionen ist zwar oft in den Nachrichten die Rede, der genaue Inhalt ist jedoch den meisten unbekannt. Ihr Schöpfer, Henry Dunant, ist heute beinahe in Vergessenheit geraten. Dabei ist das Erbe dieses tragischen Helden sehr wichtig für die Stadt Genf, die Schweiz und die ganze Welt.
Am 8. Mai 1828 wurde Henry Dunant in Genf geboren. Er stammt aus einer wohlhabenden, bürgerlichen Familie, die schon immer das Leid der Menschen bekämpft hat. Während sich Dunant schon in frühen Jahren sozial engagierte, hatte er in der Schule lange mit schlechten Noten zu kämpfen. Er entschied sich deshalb früh für eine dreijährige Lehre zum Bankangestellten. Der gläubige Christ verbrachte dabei den größten Teil seiner freien Zeit mit der Hilfe für arme Menschen. 1852 war er zunächst entscheidend an der Gründung des Genfer „Christlichen Vereins junger Männer“ beteiligt und drei Jahre später erneut. Diesmal als Delegierter an der Gründung des Weltbundes des CVJM in Paris. Der heutige „Christliche Verein junger Menschen“, ist derzeit die größte Jugendorganisation der Welt.
Im Auftrag seines Arbeitgebers, der „Genfer Handelsgesellschaft der Schweizer Kolonien von Sétif“ reiste er durch Algerien und Tunesien. Davon inspiriert gründete er 1856 kurzerhand seine eigene Mühlengesellschaft im französisch besetzten Algerien. Alles war vorbereitet, bis auf ein elementares Problem, das es noch zu lösen galt. Die versicherte Landkonzession und die Wasserrechte, die Dunant dringend für seine Mühlengesellschaft brauchte, machten Probleme. Bei den unkooperativen Kolonialbehörden steiß er auf Ignoranz und so beschloss er, sich direkt an Napoleon III. zu wenden. Als Dunant im Juni 1859 nach Italien zu Napoleon reiste, wurde er Zeuge eines Massakers. In der Schlacht von Solferino, in der Napoleon gerade gegen das Kaisertum Österreich kämpfte, lagen viele tausende Verwundete sterbend am Boden. „Seit drei Tagen sehe ich in jeder Viertelstunde einen Menschen unter unvorstellbaren Qualen sterben“, schrieb Dunant damals. Mit den Bewohnern der umliegenden Dörfer half Dunant unaufhörlich den Verwundeten. Zurück in Genf schrieb Dunant ein Buch, in dem er die Grausamkeit der Schlacht schilderte. Dabei stellte er das erste Mal eine bahnbrechende Frage in den Raum:
"Wäre es nicht ratsam, freiwillige und neutrale Hilfsorganisationen zu gründen, die den Verwundeten der Schlacht helfen?"
Seine Gedanken stießen auf großen Zuspruch und so wurde 1863 über seine Idee in der Genfer Gemeinnützigen Gesellschaft debattiert. Die Mitglieder stimmten Dunants Vorstellungen zu und machten ihn selbst zu einem Mitglied. Die Kommission wandelte sich daraufhin in eine ständige Einrichtung, die heute als das Rote Kreuz weltweit bekannt ist. In der folgenden Zeit reiste Dunant durch ganz Europa, um mit Politikern und Militärs seine Gedanken zu teilen. Nur ein Jahr später verpflichteten sich zwölf Staaten zur Einhaltung der ersten Genfer Konvention, dem Abkommen zur „Verbesserung des Schicksals der verwundeten Soldaten der Armeen im Feld“.
Verstoßen, ruiniert und gebrochen
Sein persönliches und finanzielles Dasein brach währenddessen langsam in sich zusammen. Seine Mühlengesellschaft ging bankrott, woraufhin er in Genf aufgrund seiner Algerienspekulationen verurteilt wurde. Er muss das Rote Kreuz und die Stadt Genf ruiniert verlassen. Durch das Gefühl, von seinen Aktionären und Widersachern verfolgt zu werden, trieb es ihn bis nach Paris. Verstoßen von dem, was ihm am meisten bedeutet, fiel Dunant weiter in tiefe Depressionen. In ärmlichen Verhältnissen hauste er zu dieser Zeit in Paris. Dort gründete er unter anderem die "Allgemeine Fürsorgegesellschaft" und die "Allgemeine Allianz für Ordnung und Zivilisation". Auf einer Rede in London, bei der er sich zur Frage der Kriegsgefangenen äußerte, brach er aufgrund eines Schwächeanfalls durch Unterernährung zusammen.
Trotz seiner wachsenden Schulden, warb Dunant weiter für humanitäre Themen. Nur noch wenige Mitglieder der Rotkreuzbewegung kannten seinen Namen und er versank weiter in seinen Depressionen. Er zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und fing an, seine Mitmenschen zu meiden. Dunant reiste von Stadt zu Stadt, bis er 1881 in Heiden im Appenzell einkehrte. Das einzige, was ihn damals vor der Obdachlosigkeit und Verwahrlosung bewahrte, war die kleine monatliche Unterstützung seiner Verwandten.
1889, verstoßen aus seiner Heimat und vergessen von der Welt, ließ er sich ins Spital der Stadt einweisen und schrieb seine Memoiren nieder. Doch Dunant sollte noch einmal einen unerwarteten Wiederaufstieg erleben. Nachdem eine Zeitschrift die Verdienste Dunants zurück in die Köpfe der Menschen rief, erhielt er zahlreiche Ehrungen auf der ganzen Welt. Gekrönt wurde sein Wirken mit dem ersten Friedensnobelpreis 1901. Dabei mieden seine ehemaligen Mitstreiter in Genf weiter jeglichen Kontakt. Dunant, der selbst nie etwas von dem Preisgeld zu sehen bekam, lebte bis zu seinem Tod 1910 weiter im Spital in Heiden. Geprägt waren seine letzten Jahre von Depressionen, Schuldgefühlen für seine unbeglichenen Schulden und Angstzuständen vor der Verfolgung durch Gläubiger und Widersacher.
Dem Leben des Visionärs ist heute ein Museum in Heiden gewidmet. Das Henry-Dunant-Museum ist im Gebäude des alten Spitals untergebracht, in dem Dunant bis zu seinem Tod lebte. Im Inneren des Museums kann man das Leben und Wirken des Humanisten bestaunen. Zur Zeit wird das Museum umgebaut, um dann Anfang 2024 neu eröffnet zu werden.

Das Rote Kreuz
Das Rote Kreuz besteht heute aus einer Vielzahl von Organisationen, die alle in ihren gemeinsamen Grundsätzen und Werten vereint sind. In fast allen Ländern der Welt sind Organisationen unter dem Roten Kreuz oder im islamischen Raum unter dem Roten Halbmond aktiv. Dass das Rote Kreuz an das Schweizerkreuz erinnert, ist kein Zufall. Dunant zu Ehren wurde die Schweizerfahne einfach farblich umgekehrt. So wird Neutralität nach Schweizer Vorbild demonstriert und der weiße Grund greift die militärische Tradition der weißen Fahne auf, dem Erkennungszeichen einer nicht kämpfenden Einheit.
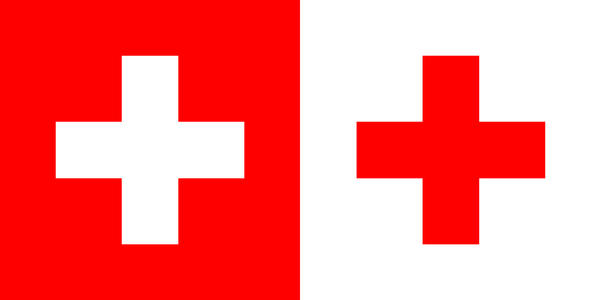
Ein Leben ohne das Werk Henry Dunants ist heute unvorstellbar. Zu Ehren Dunants findet jährlich am 8. Mai, dem Geburtstag von Dunant, der Weltrotkreuztag statt. Wenn Sie mehr zu dem Visionär und seinem Erbe wissen und erleben möchten, dann ist das Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum in Genf die richtige Adresse. In der Ausstellung erleben Sie einen umfassenden Einblick in die humanitäre Arbeit der Organisation und Henry Dunants.

Genfer Konventionen
Der gleichnamige Hauptort des Kantons Genf wird nicht umsonst auch "Hauptstadt des Friedens" genannt. Die erste Konvention von 1864 wurde später überarbeitet und durch drei weitere Abkommen ergänzt.
- Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde
- Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte zur See
- Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen
- Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten
Ergänzt wurden sie ebenfalls noch durch drei Zusatzprotokolle, da sich die Kriegsführung im Laufe der Zeit deutlich verändert hat. Die von 196 Staaten anerkannten Genfer Konventionen bilden den Grundpfeiler des humanitären Völkerrechts und sorgen für eine gerechtere, friedlichere und bessere Welt.