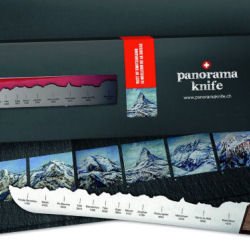Sichert die Vorgärten, die «Stäcklibuebe» kommen!

Die ersten Sonnenstrahlen brechen am Morgen sanft durch das Fenster und wecken die Sinne. Mit einer Tasse Kaffee in der Hand geht es dann hinaus, schließlich muss mal ein Blick in den Briefkasten geworfen werden. Doch dann bleibt der Blick am Vorgarten hängen: Was ist hier passiert? Wo sind die Blumentöpfe, der Rasenmäher, Mülltonnen, Bänke, Stühle und der geliebte Gartenzwerg geblieben? Ein kurzer Moment der Verwirrung, dann dämmert es allmählich auch im Kopf: Es ist der erste Mai. Die «Stäcklibuebe» verschiedenster Gemeinden in Solothurn, Aargau und Bern haben in der Vornacht ihr alljährliches Unwesen getrieben und der Vorgarten war wohl wieder einmal das Ziel ihrer nächtlichen Streifzüge. Ein Brauch, der trotz seiner teils kuriosen Ausmaße tief in der Tradition verwurzelt ist.
Ursprung und Sinn des Unsinns
Die Tradition der «Stäcklibuebe» hat wahrscheinlich ihren Ursprung in der Zeit der französischen Herrschaft unter Napoleon in der Schweiz. Während der napoleonischen Kriege verpflichtete Napoleon tausende Schweizer Männer zum Kriegsdienst. Da sich die wenigsten für einen Fremdherrscher als Kanonenfutter hergeben wollten, wurde der Entscheid, wer sich aus dem Dorf «freiwillig» zu melden hatte, häufig durch das «Stäckli zieh» entschieden. Wer das kürzere Stöckchen zog, musste sich zum Kriegsdienst melden. Die unglücklichen Verlierer dieses Spiels mussten ihren Frust bei einem Besuch in der Dorfbeiz im ein oder anderen Bier ertränken.
Spät in der Nacht, wenn der Alkohol seine Wirkung zeigte, zogen die Jungen in Gruppen durch die Straßen, stahlen aus den Vorgärten allerlei Dinge, die nicht niet- und nagelfest waren. Im Anschluss brachten sie diese zu einem gemeinsamen Sammelpunkt im Dorf und stellten sie dort einfach ab. Dieses unverschämte «Verschleipfe» (hochdt.: «Verschleppen») sorgte dafür, dass die Bewohner am nächsten Morgen mit einer bösen Überraschung aufwachten. Sie mussten ihre gestohlenen Gegenstände wiederfinden und ihren Kram aus dem ganzen Durcheinander zusammensuchen.
Im Laufe der Zeit ist diese Tradition etwas in den Hintergrund geraten, vor allem durch Änderungen bei der Rekrutierung der Wehrpflichtigen. Früher wurden junge Männer aus dem gleichen Jahrgang ihres Wohnorts zusammen einberufen. Heute hingegen können sich Wehrpflichtige ihren Rekrutierungszeitpunkt selbst aussuchen, sodass sie zu unterschiedlichen Terminen erscheinen. Außerdem wurde die einstige Aushebung in den Heimatgemeinden auf sechs nationale Rekrutierungszentren verlagert. Die Rekrutierungstage dauern nun bis zu drei Tage, während sie früher an einem einzigen Tag stattfand. Ein Teil der Tradition, der damals die nächtliche «Verschleipferei» noch gewissermaßen entschuldigte, ist somit ein Stück weit verloren gegangen. Dennoch lebt der Brauch der «Stäcklibuebe» und heutzutage auch «Stäcklimeitli» immernoch weiter, wenn auch in etwas anderer Form.

Das «Verschleipfen» und der zeitlose Liebesbeweis
Heute tragen nur noch diejenigen den Titel Stäcklibueb oder Stäcklimeitli, die im vergangenen oder aktuellen Jahr 18 Jahre alt geworden sind. Seit dem 20. Jahrhundert hat sich der Brauch mit dem «Maitannli» vermischt und dadurch einen neuen Aufschwung erfahren. Ende April ziehen die jungen Männer des Jahrgangs in den Wald, fällen Tannen und stutzen sie sorgfältig zurecht. Danach schmücken sie die Maibäume mit buntem Krepppapier. In der Nacht zum 1. Mai stellen sie die Maitännli heimlich und leise im Vorgarten der Mädchen auf, die sie begeistern wollen. Die Mädchen müssen dann herausfinden, von welchem jungen Mann der Baum stammt. Sie haben ein Jahr Zeit, den «Baumaufsteller» zu einem Abendessen einzuladen. Versäumen sie dies, bekommen sie im folgenden Jahr nur eine Strohpuppe. Vielerorts wird inzwischen anstelle einzelner Maitännli auch ein großer Baum auf dem Gemeindeplatz aufgestellt, der mit den Namen der Jahrgangsmädchen verziert ist.
Die Tradition der Stäcklibuebe ist heute eine Kombination der beiden Bräuche. Nach dem Aufstellen der Maitännli ziehen die Stäcklibuebe durch Kneipen und Vorgärten. Am nächsten Morgen beginnt dann die Suche nach den verschleppten Gegenständen. Wer besonders schlau ist, stellt in der Nacht zum 1. Mai seinen Sperrmüll in den Vorgarten und hofft, dass die Stäcklibuebe den Abtransport übernehmen. Gegenstände, die nach dem 1. Mai nicht abgeholt werden, müssen auf Kosten der Gemeinde entsorgt werden.

«Schutzbier» und Schadensregulierung
In vielen Dörfern kann man sich bei den Stäcklibuebe von den «Plünderungen» freikaufen. Der Erlös wird in der Regel an gemeinnützige Organisationen gespendet oder direkt «in Alkohol aufgelöst». Alternativ bietet es sich auch an, etwas trinkbares für die Stäcklibuebe vor der Tür zu platzieren («trinkbares» bedeutet in dem Fall: Bier!). Eine offizielle Organisation für die Stäcklibuebe existiert nicht, da der Brauch jedes Jahr von den Achtzehnjährigen selbstständig organisiert und gepflegt wird.
Auch wenn das Verschleipfen etwas kurios und übergriffig wirken mag, wird der Brauch in den meisten Gemeinden als Tradition geduldet, solange keine maßlosen Zerstörungen angerichtet werden. Milderer Schaden wird meist zähneknirschend akzeptiert, während Vandalismus unter Umständen auch polizeilich geahndet wird. Das Fällen des Maitännli eines Konkurrenten wird ebenfalls toleriert, solange der Baum keine Gefahr darstellt. Sollte ein Baum jedoch mitten auf der Straße liegen, wird dies als Verkehrsgefährdung angesehen und nicht toleriert. Jedes Jahr appelliert die Polizei an die Stäcklibuebe, ihren Schabernack in einem vernünftigen Rahmen zu halten. Neuzugezogene werden regelmäßig durch Flugblätter und Plakate über den Brauch informiert, um Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden.