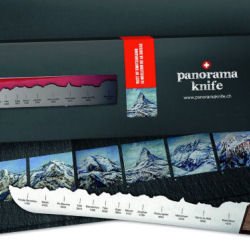Gilihüsine – wie man einer Kuh auf die Zehen schlägt

Ruhe. Herrliche Ruhe. Frische und saubere Bergluft. Der Duft der Arvenwälder und Alpwiesen. Den Kopf frei und den Stress von der Seele wandern. Dafür fahre ich regelmäßig ins Wallis auf die Bettmeralp. Im Herbst ist Zwischensaison, also unendliche Ruhe und nur wenige Menschen. Die Luft ist zwar recht kühl auf 2000 Metern Höhe, dafür aber auch sehr klar mit unbegrenzter Sichtweite. Im Gegensatz zum Sommer ist auch die Sonnenbrandgefahr deutlich geringer. So brauche ich meine mozzarellafarbenen Waden nicht auch noch mit weißer Sonnencreme zu tünchen.
 Die Sonne scheint und der Himmel ist wolkenlos. Perfektes Wetter für eine kleine Wanderung via Riederalp, Aletschwald, Moosfluh, am Bettmersee vorbei und schließlich in meiner Stammkneipe ein leckeres, erfrischendes Walliser Bier als Belohnung. Wahrscheinlich werden es auch zwei und ich komme mal wieder erst kurz vor Ladenschluss am Supermarkt vorbei, um für das Abendessen einzukaufen. Klingt nach einem perfekten Tagesplan. Doch Pläne hat man bekanntlich, um sie über den Haufen zu werfen, wenn ein besserer Plan daherkommt. Das passiert dort oben ständig.
Die Sonne scheint und der Himmel ist wolkenlos. Perfektes Wetter für eine kleine Wanderung via Riederalp, Aletschwald, Moosfluh, am Bettmersee vorbei und schließlich in meiner Stammkneipe ein leckeres, erfrischendes Walliser Bier als Belohnung. Wahrscheinlich werden es auch zwei und ich komme mal wieder erst kurz vor Ladenschluss am Supermarkt vorbei, um für das Abendessen einzukaufen. Klingt nach einem perfekten Tagesplan. Doch Pläne hat man bekanntlich, um sie über den Haufen zu werfen, wenn ein besserer Plan daherkommt. Das passiert dort oben ständig.
Die Wanderung verläuft zunächst wie geplant und erwartet. Keine Menschenseele läuft mir über den Weg. Nur ein paar Gemsen und ein paar Murmeli, die ihrem Winterspeck noch den letzten Schliff geben müssen. Ab und zu krächzt ein Tannenhäher von einem Baum, der gerade an einem Tannenzapfen für seinen Wintervorrat verzweifelt. Auf der Moosfluh, hoch über dem Aletschgletscher, herrscht Totenstille. Von hier aus geht es nur noch Bergab zur Bettmeralp zurück. Doch schon beim steilen Abstieg erkenne ich, warum mir kein Mensch über den Weg läuft. Unten am Bettmersee scheint sich das ganze Dorf versammelt zu haben. Das war es dann wohl mit der Ruhe. Je weiter ich mich an den See heranpirsche, desto mehr erkenne ich. Einen Pavillon, Sonnenschirme, Stehtische, Zeltbänke, einen rauchenden Grill und so etwas wie ein Spielfeld, abgesteckt mit kleinen Walliserfähnli, mitten auf der unebenen, zum Seeufer abfallenden Wiese. Jetzt hört man auch eine Musikkapelle mit Schwyzerörgeli und Klarinette. Ich stelle fest: Ein Fest!
 Neugierig bin ich ja schon, und wenn ich schon da vorbeikomme, dann werde ich dieses Fest mal aus der Nähe betrachten. Bier wird auch gezapft, dann spare ich mir halt den Weg zur Kneipe. Das gesamte Kneipenpersonal ist eh hier am See und die Kneipe dementsprechend wohl eher geschlossen. Einer der Kellner erkennt mich wieder und bietet mir einen Platz neben sich am Biertisch an. Ich besorge mir noch schnell ein Bier und nehme seine Einladung an. Dass die Walliser besonders gut feiern können ist schließlich bekannt. Die Einheimischen haben sich fein in alte, traditionelle Kleidung aus Omas und Opas Kleiderschrank gewickelt. Die Damen in schwarze Röcke oder Kleider mit weißen Spitzenschürzen darüber, die Herren in schwarze oder braune Stoffhosen und weiße Hemden mit Stoffweste oder Anzugjacke darüber. Ein Hut mit breiter Krempe und eine Pfeife oder krumme Zigarre zieren den Kopf. Auch viele Kinder sind dabei, ebenfalls wie die Erwachsenen gekleidet. Die Pfeifen in deren Mundwinkeln rauchen im Gegensatz zu den Pfeifen der Erwachsenen natürlich nicht. Die Stimmung ist eines Walliser Festes würdig. Die Musikkapelle unterbricht ihren flotten Schottisch für eine Durchsage. Das Organisationskomitee ruft die Mannschaften „Bier zu Null“ und „die Rausschmeißer“ zum Spielfeld. Das kann nur lustig werden!
Neugierig bin ich ja schon, und wenn ich schon da vorbeikomme, dann werde ich dieses Fest mal aus der Nähe betrachten. Bier wird auch gezapft, dann spare ich mir halt den Weg zur Kneipe. Das gesamte Kneipenpersonal ist eh hier am See und die Kneipe dementsprechend wohl eher geschlossen. Einer der Kellner erkennt mich wieder und bietet mir einen Platz neben sich am Biertisch an. Ich besorge mir noch schnell ein Bier und nehme seine Einladung an. Dass die Walliser besonders gut feiern können ist schließlich bekannt. Die Einheimischen haben sich fein in alte, traditionelle Kleidung aus Omas und Opas Kleiderschrank gewickelt. Die Damen in schwarze Röcke oder Kleider mit weißen Spitzenschürzen darüber, die Herren in schwarze oder braune Stoffhosen und weiße Hemden mit Stoffweste oder Anzugjacke darüber. Ein Hut mit breiter Krempe und eine Pfeife oder krumme Zigarre zieren den Kopf. Auch viele Kinder sind dabei, ebenfalls wie die Erwachsenen gekleidet. Die Pfeifen in deren Mundwinkeln rauchen im Gegensatz zu den Pfeifen der Erwachsenen natürlich nicht. Die Stimmung ist eines Walliser Festes würdig. Die Musikkapelle unterbricht ihren flotten Schottisch für eine Durchsage. Das Organisationskomitee ruft die Mannschaften „Bier zu Null“ und „die Rausschmeißer“ zum Spielfeld. Das kann nur lustig werden!
Ich frage den netten Kellner, was eigentlich gespielt wird. Er antwortet: „Gilihüsine!“, worauf ich ihm freundlich „Gesundheit!“ wünsche. Er lacht laut los und erklärt: „Nei, das Spiel heißt Gilihüsine!“ Dieses Walliserdeutsch ist aber auch schwer zu verstehen! Auf meine Frage, was dieses Wort überhaupt bedeutet, schüttelt er nur den Kopf und stellt fest: „Das weiß niemand hier.“ Wir grinsen beide. Inzwischen hat sich die eine Mannschaft auf dem Spielfeld mit seltsamen Holzbrettern bewaffnet, die mich an die Bretter der Pizzabäcker erinnern, mit denen sie die Pizza in den Ofen schieben. Nur der Stiel ist hier kürzer. Die andere Mannschaft steht neben dem Spielfeld an einem schräg in Richtung des Spielfeldes gerichteten Baumstamm. Hier bewaffnet sich nur einer und zwar mit einem etwa zwei Meter langen Stock. Ich schaue den Kellner fragend an. Er holt aus zur Erklärung des Spiels: „Aaalso...“
Zur allgemeinen Verständlichkeit, werde ich selbst an dieser Stelle die Erklärung übernehmen, und sie aus dem Walliserdeutschen übersetzen:
Aaalso. Der schräg aufgelegte Baumstamm ist eine Abschlagrampe, der „Bock“. Auf dem vorderen Ende liegt der Zehenknochen einer Kuh, die sogenannte „Beinkuh“. Der Spieler mit dem langen Erlen- oder Haselstock holt aus wie beim Golf und schlägt den Knochen in das mit Fähnchen abgesteckte Spielfeld, das „Geriss“. Dazu hat er drei Versuche. Die Mannschaft mit den Brettern im Geriss, den sogenannten „Guferschindeln“, muss versuchen, den fliegenden Kuhzehenknochen mit ihren Schindeln zu treffen, bevor er im Geriss zu Boden geht. Man nennt es „abtun“. Die Schindeln dürfen dazu auch geworfen werden. Sollte ihnen das nicht gelingen, erhält die schlagende Mannschaft einen Punkt. Jede Mannschaft hat sechs Spieler. Wenn alle sechs der einen Mannschaft geschlagen haben, gehen sie selbst ins Geriss, übernehmen die Schindeln und die andere Mannschaft ist mit dem Schlagen der Beinkuh an der Reihe. Wenn jede Mannschaft zwei Durchgänge gespielt hat, ist das Spiel zu Ende und die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt. Die Verlierermannschaft muss dann den Siegern eine Runde Getränke spendieren.

Das Ganze sieht nicht nur ulkig aus, sondern scheint auch Spielern wie Zuschauern einen irren Spaß zu bereiten. Die alten Klamotten und das rustikale Spiel selbst lassen schon darauf schließen, dass es ein uralter Brauch sein muss. Der Kellner bestätigt das. Die Dörfer im Goms waren jahrhundertelang im Winter durch den Schnee von der Außenwelt abgeschnitten. Manche Gemeinden müssen sogar heute noch im Winter per Helikopter mit Lebensmitteln versorgt werden. Verständlich, dass die Schneeschmelze im Frühling nach Walliser Manier gefeiert werden musste. Sobald die ersten Wiesen schneefrei waren, trafen sich dort die Walliser, schnitzten oder zimmerten ihre Schindeln, kochten eine Suppe, aus welcher der frisch abgekochte Kuhzehenknochen herausgefischt wurde, um ihn ins Geriss zu prügeln. Erst im Zweiten Weltkrieg schlief dieser uralte Brauch ein. 1953 organisierte zwar ein Dokumentarfilmer noch ein mal ein Spiel auf der Bettmeralp, um es auf Film für die Nachwelt festzuhalten, aber auch der Film geriet schließlich in Vergessenheit. Erst 2010 wurde das Spiel vom Tourismusverein der Bettmeralp im Herbst wiederbelebt, nachdem man die alten Filmaufnahmen entdeckt hatte. Zum einen hat man wieder ein schönes Traditionsfest für die Einheimischen geschaffen, zum anderen lockt das Fest auch im Herbst Touristen auf die Alp.
Heute nehmen dreizehn Mannschaften teil. Mittlerweile kommen sogar Mannschaften aus der ganzen Schweiz zur Bettmeralp. Jeder kann mitmachen oder gleich eine ganze Mannschaft anmelden. Die Teilnahme ist übrigens kostenlos. Eine weiterentwickelte, moderne Version des Gilihüsine ist das Hornussen, was heute überall in der Schweiz gespielt wird und sich zu einem professionellen Nationalsport entwickelt hat. Die Stöcke sind dort eher „Peitschen“ aus Fiberglas mit einem Holzklotz am Ende und die Kuhknochen sind aus Kunststoff. Mit diesen modernen Geräten fliegt das Geschoss natürlich auch schneller und weiter, weshalb die Spielfelder auch entsprechend größer sind. Während Gilihüsine auf etwa 50 Meter beschränkt ist, wird Hornussen über mehrere hundert Meter gespielt. Das dürfte für Laien eher weniger geeignet sein. Beim Gilihüsine sind aber auch professionelle Hornusser am Start.
Gilihüsine ist jedenfalls ein Spiel für alle. Neben dem großen Spielfeld für die Erwachsenen ist auch ein kleineres mit kleinerem Abschlagbock und kürzeren Stöcken für die Kinder abgesteckt. Allein das Zusehen macht schon einen Heidenspaß. Besonders das Fehlen eines Videoschiedsrichters, der kontrollieren kann, ob die Beinkuh noch im Geriss oder knapp außerhalb gelandet ist, verleiht dem Spiel noch die Extraportion Pfeffer und Spannung. Da habe ich doch glatt vor lauter Spaß meinen ursprünglichen Tagesplan mit Ruhe und Kneipe vergessen. Aber es kam natürlich viel besser. Für das Abendessen brauche ich jetzt auch nicht mehr einzukaufen. Ich verabschiede mich vom Kellner und spaziere zurück zu meinem Chalet.
Unterwegs frage ich mich erstaunt, warum das Spiel noch nicht weiter verbreitet wurde. Dabei wäre es doch ein geniales Spiel für Straßenfeste, Dorffeste, Familienfeiern, Kindergeburtstage oder was auch immer. Man braucht nur eine große Wiese, die nicht mal plan wie ein Fußballplatz sein muss. Sie darf ruhig ein Gefälle, wie auch am Bettmersee haben. Selbst am Strand wäre es möglich. Die Größe des Spielfeldes ist variabel. Material für Stöcke, Bock und Schindeln bekommt man für kleines Geld im Baumarkt, wenn man keinen Wald zur Verfügung hat. Einen Kuhzehenknochen bekommt man beim Metzger, oder man nimmt einfach etwas völlig anderes mit ähnlicher Beschaffenheit. Improvisation und Fantasie sind herzlich willkommen und geben dem Spiel erst seinen Charakter. Bis ich das nächste Mal auf die Bettmeralp zum Gilihüsine komme, werde ich zu Hause geübt haben!