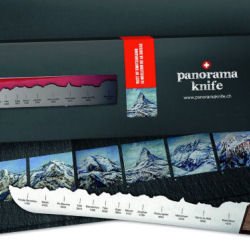Auf Krawall gebürstet: Eringer Kampfkühe im Wallis

Aufgeregtes Treiben herrscht zum Frühlingsbeginn in den Freiluftarenen des Schweizer Kantons Wallis. Tausende Zuschauer tummeln sich auf den Rängen und erwarten gespannt das Einlaufen der Kühe. Es handelt sich nicht um irgendwelche Kühe, sondern um die alte Walliser Traditionsrasse der Eringer Kühe, benannt nach dem Val-d'Hérens, auf Deutsch Eringertal, im Unterwallis. Diese muskulösen, schwarz bis kastanienbraunen Tiere mit ihren kurzen Beinen und dem mächtigen, behornten Schädel wirken auf den ersten Blick aus der Distanz recht niedlich. Mit ihrem gemächlichen Gang und ihrer entspannten Haltung könnte man fast meinen, sie seien in jeder Hinsicht die Ruhe in Person (oder eher «in Kuh»), doch dieses Bild täuscht im wahrsten Sinne des Wortes «gewaltig».
Friedlich, oder doch «auf Krawall gebürstet»
In den sonst so ruhigen Tieren schlummert ein außergewöhnlicher Kampfgeist. Wenn die Kuhherden im Frühling auf die Alpen getrieben werden, haben die Kühe zunächst nur eines im Sinn: Sie müssen die Hierarchie innerhalb der Herde festlegen. Die Rangordnung in einer Herde ist für das Überleben notwendig, und dies wird - wie auch bei vielen anderen Tierarten - durch den Kampf um die Führungsposition bestimmt. Naturgemäß duellieren sich die weiblichen Tiere der Herde untereinander. Diese Kämpfe dauern an, bis sich eine der beiden Kühe demütig zurückzieht. Manchmal gibt sie beim Anblick einer größeren, älteren und offenbar stärkeren Kuh sogar kampflos auf. Die Siegerin wird die sogenannte Leitkuh der Herde.
Der Kampf, der hier in den Walliser Alpen ausgetragen wird, ist seit über 100 Jahren nicht mehr nur ein Kampf um die Hierarchie, sondern hat sich zu einer fest verankerten Tradition entwickelt. Es ist zu einem regelrechten Spektakel, sowohl für die Züchter als auch für die Zuschauer geworden, die sich jedes Jahr aufs Neue versammeln, um Zeuge dieses außergewöhnlichen Ereignisses zu werden. Was als spaßiger Zeitvertreib unter Kuhzüchtern begann, hat sich inzwischen zu einem gesellschaftlichen Ereignis entwickelt, das auch als ernstzunehmender Sport anerkannt wird. Für ein Fest mit Raclette und Wein ist den geselligen Wallisern bekanntlich jeder Anlass recht.
In der Freiluftarena werden zeitgleich zehn Kühe von ihren Züchtern in den Ring geführt, während die Zuschauer gespannt auf den Beginn des Kampfes warten. Die Kühe treten in einem Duell gegeneinander an, bei dem es nicht nur um den Sieg, sondern auch um Ehre und Respekt geht.

Showdown: Das große Stechen
Ein eiserner Blick fixiert die ausgewählte Gegnerin, mit scharrenden Hufen und gesenktem Kopf wird die Kampfbereitschaft deutlich signalisiert. Dann geht es los: Die etwa 700kg schweren Tiere stürzen aufeinander zu und die massigen, gehörnten Schädel krachen gewaltvoll zusammen. Mit aller Kraft schieben und drücken sich die Kontrahentinnen durch die Arena, immer weiter und weiter, bis eine Kuh ihre Unterlegenheit einsieht. Dies geschieht in der Regel ganz einfach durch Zurück- oder Ausweichen. Hat eine Kuh drei Kämpfe verloren oder verweigert sie den Kampf, wird sie aus dem Ring geführt. Der Kampf wirkt vor allem bei den größeren Tieren eindrücklich hart, doch es geht stets nach den Regeln der Natur. Eine Kuh, die nicht kämpfen will, kämpft nicht.
Die Verliererinnen werden von ihren Besitzern aus dem Ring geführt und liebevoll mit Leckerbissen empfangen. Die Gewinnerin des regionalen «Stechfests» erhält als Symbol für ihren Erfolg eine nagelneue Glocke und wird als «Königin» gekrönt. Diese Zeremonie hat etwas Feierliches und würdigt den Kampfgeist der Tiere sowie den Erfolg der Züchter, für gesunde und robuste Tiere gesorgt zu haben. Doch der Sieg auf regionaler Ebene ist nicht das Ende der Reise. Die Siegerin der regionalen Kämpfe, die sogenannte Regionalkönigin, qualifiziert sich für das kantonale Finale in Aproz. Vor über 15.000 Zuschauern - Tendenz steigend - treten dann die besten Kühe des Wallis gegeneinander an, um die Gesamtsiegerin zu küren, die als «la reine des reines» (dt.: «Königin der Königinnen») gefeiert wird.
Zur Gewährleistung der Fairness werden die Kühe in Alters- und Gewichtsklassen unterteilt. So wird dafür gesorgt, dass die Tiere auf Augenhöhe gegeneinander antreten. Sogar Dopingkontrollen wurden zeitweise eingeführt. Diese Kontrollen erwiesen sich jedoch als überflüssig, da alle Kühe «clean» waren – lediglich einige Besitzer standen oftmals unter dem Einfluss erheiternder Getränke.

Die letzten Tierkämpfe der Schweiz - Tradition oder Tierquälerei?
Der Brauch des Ringkuhkampfes besteht seit 1922 und ist tief in der Kultur des Wallis verwurzelt. Doch über 100 Jahre nach dessen Entstehung stellt sich die Frage: Wie steht es heute um diese Tradition? Die Begeisterung für die Ringkuhkämpfe hat sich mittlerweile weit über die Grenzen des Wallis hinaus verbreitet. Heute gibt es jährlich internationale Wettkämpfe zwischen Italien, Frankreich und der Schweiz, die abwechselnd in den drei Ländern stattfinden. An diesen Kämpfen nehmen nicht nur regionale Züchter teil, sondern auch Kühe aus anderen Ländern, die ihre Kraft unter Beweis stellen möchten. Es ist eine faszinierende Tradition, die immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Im Gegensatz zu vielen anderen Bräuchen, deren Popularität im Laufe der Zeit schwindet, erleben die Ringkuhkämpfe einen regelrechten Aufschwung. Es gibt jedoch auch immer wieder kritische Stimmen, die sich Sorgen um das Tierwohl machen. Sind diese Kämpfe, die einzigen in der Schweiz erlaubten Tierkämpfe, zu brutal und gefährlich für die Tiere? Werden die Kühe nur zur Belustigung der Menschen ausgenutzt? Achten die Züchter wirklich auf das Wohl der Tiere oder geht es letztlich doch mehr um Eigeninteressen und den Gewinn aus dem Spektakel?
Um diese Bedenken auszuräumen, sind bei jedem Wettkampf sowohl auf regionaler als auch auf kantonaler Ebene Tierärzte anwesend. Sie prüfen den Gesundheitszustand der Tiere sowohl vor als auch nach den Kämpfen und beobachten das Geschehen während der gesamten Veranstaltung. Sollte sich ein Tier auffällig verhalten oder Verletzungen aufweisen, wird der Kampf sofort gestoppt, und das Tier wird zur weiteren Untersuchung in die Obhut eines Arztes gebracht.

Tierwohl nach Kantonsreglement
Das Walliser Kantonsveterinäramt sorgt ebenfalls für kontinuierliche Verbesserungen der Sicherheitsvorkehrungen. Seit 2017 sind die Veranstalter verpflichtet, den anwesenden Tierärzten speziell eingerichtete Behandlungszelte zur Verfügung zu stellen. Diese Zelte sind blickdicht und mit sauberem, fließendem Wasser sowie Elektrizität ausgestattet. Die Tierärzte haben die Befugnis, kleinere chirurgische Eingriffe direkt vor Ort vorzunehmen. Durch die Zelte kann dies in guten hygienischen Verhältnissen, mit ausreichend Ruhe und in einem angemessenen zeitlichen Rahmen geschehen. Vor 2017 mussten gröbere Kampfspuren oftmals im Freien und mit nur dürftiger Fixierung der Tiere durchgeführt werden. «Das war für die zuständigen Tierärzte nicht immer ungefährlich und für Mensch und Tier mit Stress verbunden», erklärt Kantonstierarzt Jérôme Barras gegenüber dem «Walliser Bote». Tierärzte außerhalb des Wallis schätzen die Kämpfe als «wenig bis nicht belastend» für die Tiere ein. Die Kühe folgen in diesen Wettbewerben ihrem natürlichen Kampfinstinkt und seien diese Art von positivem Stress gewohnt.
Ein weiterer Schritt, der zugunsten des Tierwohls unternommen wurde, ist die Veränderung der Struktur der Veterinäraufsicht. Die anwesenden Veterinäre arbeiten nicht mehr für die Organisatoren, sondern im Auftrag des kantonalen Veterinäramts und sind damit unabhängige Kontrollinstanzen. Auf diese Weise werden Interessenkonflikte vermieden, und die Mediziner haben die Befugnis, jede Kuh aus dem Ring zu ziehen, die nicht «im vollen Besitz ihrer Kräfte» ist – unabhängig von ihrem Status im Turnier.

Tradition gegen Wirtschaftlichkeit - das Ende der Eringer-Rasse?
Die Ringkuhkämpfe sind zu einem Symbol für die Eringer-Rasse geworden. Diese Kühe seien aus wirtschaftlicher Sicht aufgrund ihrer kleinen Statur und ihres geringen Milchertrages «wirtschaftlich nicht so interessant», wie viele Züchter sagen. Lediglich wegen ihrer besonders guten Milchqualität für besten Raclette und wegen ihrer sehr guten Fleischqualität für Steaks, Bratwürste und Walliser Trockenfleisch kommt diese alte, traditionelle und robuste Rinderrasse noch zum Einsatz. Der Brauch des Ringkampfes unterstützt und fördert das Traditionsbewusstsein und schafft neue Anreize für Züchter, die Eringer-Rasse zu erhalten.
Abgesehen von den äußeren Maßnahmen, die zum Schutz der Tiere eingeführt wurden, behalten die Kühe ihren eigenen Willen. Eine Kuh, die nicht kämpfen möchte, kämpft nicht. Die Leidenschaft der Züchter und ihre Liebe zu den Tieren spielt eine große Rolle bei den Kämpfen und wird deutlich sichtbar. Oftmals haben die Kühe ein nahezu gleichwertiges Verhältnis zu ihrem Halter wie ein Familienhund. Kaum zu glauben nach der Geschichte um die Ringkämpfe, aber der besonders gutmütige und sensible Charakter der bemerkenswert intelligenten Eringerrinder macht es möglich.