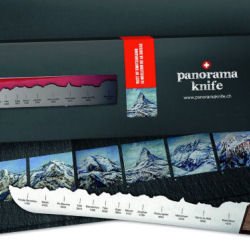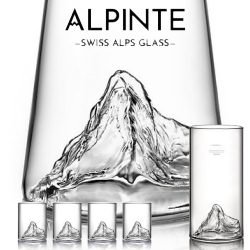Tschäggättä - Fasnacht im Lötschental

Goppenstein: Von Kandersteg, aus nördlicher Richtung das Tor zum Wallis. Eigentlich ist es eher ein kleines Türchen, wenn nicht gar ein "Schlupfloch". "Goppenstein" - das klingt, als könne es auch der Name einer finsteren Burg in einem engen Tal in einem Vampirroman sein. Ein Licht am Ende des Lötschbergtunnels stellt man sich jedenfalls schöner vor. Bis auf einen kleinen Bahnhof und nur sehr wenige, vereinzelte Häuser, zwischen Bahngleise und Felsen gepfercht, findet man jedoch nichts weiter vor. Wenigstens liegt Goppenstein in einem engen Tal. Man fährt mit dem Auto vom Autoverlad der Lötschbergbahn ab, fährt eine enge Straße zwischen den Felsen entlang, biegt rechts ab und nach ein paar Tunnels und ein paar Serpentinen befindet man sich schon im wunderschönen breiten Rhônetal. Wer, wie Ich, regelmäßig diese Strecke fährt, kennt sie in- und auswendig. Selbst wer zum ersten mal dort vom Zug abfährt, kann den Weg ins Rhônetal nicht verpassen. Die einzige Abzweigung hinter dem Bahnhof ist schließlich unmissverständlich ausgeschildert. Doch wo landet man, wenn man dort falsch abbiegt?

Lebensfeindlich, mystisch, wunderschön
Zunächst muss man mal wieder einen Tunnel passieren. Nur etwa 4km weiter erreicht man das kleine Dorf Ferden. Die enge Lonzaschlucht weitet sich allmählich, wenn auch nicht besonders viel, zu einem der abgeschiedensten Täler der Alpen, dem Lötschental. Ab Ferden hat es nur ungefähr 10km Länge. Dahinter entspringt die Lonza dem Langgletscher, hinter welchem man wiederum den mächtigen Konkordiaplatz erreicht, wo vier Gletscher zum großen Aletschgletscher zusammenfließen. Das Lötschental ist durchweg ein ziemlich enges Tal. Die vier Ortschaften, Ferden, Kippel, Wiler und Blatten liegen auf ca. 1370m bis 1540m Höhe, im Nordwesten und Südosten jeweils von imposanten Bergketten von 3300m bis knapp 4000m Höhe flankiert. Auf den ersten Blick bereits eine lebensfeindliche Gegend. Die Südflanke wird nur selten von der Sonne erreicht, in den Wintermonaten so gut wie nie. Die Lawinengefahr ist hier entsprechend hoch. Ein paar Alpsiedlungen gibt es immerhin auf der Nordflanke, darunter die Lauchneralp oberhalb Wiler, ein sehr beliebtes Skigebiet. Von dort oben wirken die hohen Bergketten etwas weniger bedrohlich als von unten im Talgrund, doch die Ortschaften wurden im Laufe der Zeit tatsächlich recht häufig von Lawinen verschüttet. Vampirgeschichten und ähnliche Folklore sind zwar bekanntermaßen reine Fiktion, eine Art mystisches Flair hat das Lötschental dennoch, besonders zwischen dem dritten Februar und dem Tag vor Aschermittwoch - zur Fasnacht.



Die "Orks" aus dem Lötschental
So mancher ahnungslose Skitourist wurde schon von ihnen heimgesucht. Selbst Frauen und Kinder sind nicht vor ihnen sicher, wenn sie über die Dörfer im Tal herfallen. Grauenvolle, buckelige Gestalten mit langen, weißen, schwarzen und braunen Pelzen, furchterregenden Fratzen, Dämonen gleich, bewaffnet mit einem langen Stock, stürmen durch die Gassen und malträtieren jeden, der ihren Weg kreuzt. Die großen Kuhglocken, die sie an einem breiten Riemen um die Taille tragen, hört man schon von Weitem. Szenen wie aus einem Herr der Ringe Roman, wo die Orks aus Mordor wie aus dem Nichts auftauchen. Doch um sein Leben fürchten muss niemand. Ein Gesicht im Schnee oder ein Kopf im Schwitzkasten - mehr hat man nicht zu befürchten. Die Dämonenfratzen sind nur Masken aus Holz und darunter stecken natürlich Menschen. Holzmasken und Kuhglocken mögen vielleicht an das Silvesterchlausen im Appenzell erinnern, aber damit hat dieser Brauch im Lötschental recht wenig zu tun. Der Ursprung dieses Brauches lässt sich, mangels Aufzeichnungen, kaum zurückverfolgen. Noch lange Zeit nach dem Mittelalter gab es in den abgelegenen Tälern nur äußerst selten jemanden, der lesen und schreiben konnte. Eine Verwandschaft des Brauches mit der "alemannischen Fasnacht" heidnischen Ursprungs, wo der Winter mit Masken ausgetrieben wurde, liegt aber nahe. Eine weitere Theorie führt zu den Schurtendieben und schon wieder klingt es nach einer Geschichte aus Tolkiens Romanen:
In finsterer Nacht fielen die Schurtendiebe aus den dunklen Wäldern der Schattenseite des Tals über die friedlichen Dörfer her.
Gekleidet in Tierfelle und vermummt mit Holzmasken plünderten sie jedes Haus und kein Mensch war vor ihnen sicher.


Hinter der Maske
Um 1900 kamen Volkskundler in das Lötschental und bemerkten diesen Brauch, der mit so viel Aufwand und Hingabe gepflegt wird. Die Junggesellen des Tals verkleideten sich, um auf diese Weise eine Frau zu finden. Zugegeben, ein recht fragwürdiges Balzverhalten, bei dem man sich maskieren und verkleiden muss, um einer Frau den Hof zu machen. Heute geht es bei dem Brauch natürlich nicht mehr um die Balz. Das funktioniert in unserer modernen und aufgeklärten Gesellschaft schließlich inzwischen auch digital per App. Hauptsächlich junge Männer verkleiden sich heute, aber auch Frauen und Kinder stecken manchmal in den Kostümen. Diese bestehen aus einer Hose, die aus Kartoffelsäcken genäht wird, einer umgestülpten Jacke, zotteligen, dicken Handschuhen, einem großen Polster auf den Schultern, dass sie buckelig und noch größer erscheinen lässt und den Tierfellen, denen diese Fantasiewesen ihren Namen verdanken: Tschäggättä. Das soll ein Wort sein, fragen Sie sich? Ja, das ist es! Es ist sogar deutscher, als Sie denken. Im Wallis herrscht zwar ein allgemein schwer verständlicher Dialekt, aber dieses Wort bekommen wir hin.
Begriffsklärung: "Tschäggättä"
Eine Kuh, ein Hund oder irgendein anderes Tier mit mehrfarbig geflecktem Fell ist "gescheckt". Die Lötschentaler Fantasiewesen sind demnach "gescheckte". Im Mittelhochdeutschen sagte man noch "geschecket", um diese Fellfarben zu beschreiben. So wären sie schonmal "gescheckete". Für den Walliser klingt das noch nicht schön genug. Er vereinfacht die Vorsilbe "ge-" einfach zu einem "t", aus den "e" werden "ä" und aus dem "ck" wird "gg". So sind die Wesen also nicht mehr die "Gescheckten", sondern die "Tschäggättä". Das klingt schon viel unheimlicher. Bei "gescheckt" müsste man eher an süße, kleine Meerschweinchen oder dergleichen denken.
Das Wort "Tschäggättä" ist also, genau betrachtet, gar nicht so ungewöhnlich für den Walliser Dialekt. Die Hose nennen sie "Sackhosä" - auch wenig ungewöhnlich. Die walliserdeutschen Begriffe für die Handschuhe ("Triämhändschen") und die Schulterpolster ("Boimtragärchischi") zu erklären, werde ich hingegen gar nicht erst versuchen. Lassen wir dem Wallis lieber seine Geheimnisse.

Marketing-Event oder lohnenswerter Kult?
Die eigentlichen Meister hinter den Kulissen, sind die Maskenschnitzer. Jede Maske ("Larve") wird von Hand aus Arvenholz geschnitzt. Jede Maske ist ein Unikat. Getragene Masken sind in der Regel unverkäuflich und landen als Erinnerungsstück an einer Wand der Schnitzstube, im Lötschentaler Museum in Kippel oder im Lötschentaler Fasnachtsmuseum in Wiler. Dort können Sie übrigens auch ganzjährig bewundert werden. Aber auch für Touristen werden Masken in sämtlichen Größen als Souvenirs geschnitzt. Wem diese Souvenirmasken nicht genügen, der hat die Möglichkeit, einen Maskenschnitzkurs zu machen und seine Maske nach Belieben selbst zu gestalten. Auch diese werden ganzjährig angeboten.



Damenherzen werden die Tschäggättä heute wohl nicht mehr anziehen, dafür aber ganz sicher die Skitouristen. Inzwischen gelten sie sogar als nationales Markenzeichen und die Lötschentaler Fasnacht mit den Tschäggättä ist wirklich weitaus mehr als nur ein leeres Marketingversprechen. Über zweieinhalb Wochen sind die Terminkalender im Tal voll. Jeden Abend streunen Tschäggättä durch die Gassen und Beizen und treiben Ihre Spielchen mit den Leuten. In den großen Umzügen zum Abschluss der Fasnacht mit Guggenmusik präsentieren sie ihre Kostüme und lassen sie prämieren. Wer also in Goppenstein immer brav der Beschilderung Richtung Wallis oder Autoverlad folgt, der sollte es vielleicht doch einmal wagen, "falsch" abzubiegen und den Schildern ins verzaubernd verrückte Lötschental ("Paradies") zu folgen.