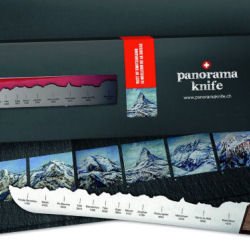Fasnacht in der Schweiz - Welcher Kanton hat mehr Humor?

Nahezu jeder Ort in der Schweiz hat seine eigene Art, die Fasnacht zu feiern. Auf den ersten Blick sind kaum Unterschiede erkennbar, doch auf den zweiten Blick zeigt sich oft ein feiner Humor, den man - gemäß entsprechender Vorurteile - manchen Regionen gar nicht zugetraut hätte. Beweisen diese Fasnachtsbräuche am Ende etwa, dass Schweizer doch tatsächlich einen guten Sinn für Humor haben, der auch noch in teils uralten Traditionen verwurzelt ist?
Umzüge mit lauter Musik, bunte Kostüme, aufwendig dekorierte Wagen, Bier und Kafi fertig im Überfluss und Konfetti klebt auf den Straßen - so wird eigentlich überall die Fastenzeit eingeläutet, in der Schweiz, in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Brasilien, in New Orleans und sogar in Namibia. Traditionsgemäß überlässt die Obrigkeit dem feiernden Volk für ein paar Tage die Stadt, bevor der christliche Glaube bis Ostern eine Zeit strengen Verzichts anordnet. Da darf man es die letzten Tage davor doch ruhig noch einmal ordentlich krachen lassen, oder? Zugegeben, die Fastenzeit spielt heute kaum noch eine Rolle in der modernen, säkularisierten Gesellschaft, aber es wäre doch schade um die schönen, alten Fasnachtsbräuche, wenn man auch noch diese verwürfe.
Die kuriosesten Fasnachtsbräuche der Schweiz
Luzern: «Fötzeliräge»
In Luzern wird am «Schmutzigen Donnerstag» die Fasnacht mit einem «Urknall» und anschließendem «Fötzeliräge» eröffnet. 300 alte Telefonbücher werden dazu jedes Jahr in ca. 4x4cm große Schnipsel («Fötzeli») geschreddert und in Müllsäcke gestopft, die man über den Köpfen der Narren sprengt. Die Freude der Menschen über diesen Schnipselregen («Fötzeliräge») ist unermesslich. Leider droht dieser Brauch auszusterben: Telefonbücher werden nicht mehr produziert. Immerhin hat die Fasnachtsgesellschaft der Digitalisierung entgegengewirkt, indem sie alte Restbestände der einst so zahlreich verfügbaren Nachschlagewerke aufgekauft, gesammelt und für die nächsten Jahre eingelagert hat. Doch was dann?

St. Gallen: «Födlebürger-Verschuss»
Fröhliche Musik in allen Gassen - so kennt man die Fasnacht. In St. Gallen hingegen spielt man einen Trauermasch auf einem «Hinrichtungsplatz». Diese Tradition stammt erstaunlicherweise nicht aus dem Mittelalter, sondern aus dem Jahr 1972. Ein paar Guggemusiker lamentierten bei reichlich Bier über das lästige Spießbürgertum der Stadt und der Presse. Schließlich hatte einer der betankten Herren die glorreiche Idee, «man müsse halt mal einen dieser Spießbürger (SG-Dialekt: «Födlebürger»; wörtlich hochdeutsch übersetzt: «Popobürger») erschießen. Dann kämen wir in die Zeitung und St. Gallen hätte einen Spießer weniger.» In Ermangelung williger Spießbürger wird seither in jedem Jahr eine beliebte Persönlichkeit der Stadt auf dem Platz mit einer riesigen Konfettikanone «erschossen» und dadurch zum «Ehren-Födlebürger der Stadt St. Gallen» getauft. Zuvor darf sie allerdings noch gnädigerweise drei Wünsche vortragen.
Zug: Greth Schell
Gerade konservativen Kreisen der Schweizer Mannen sagt man häufig ein recht fragwürdiges Frauenbild nach. In Zug lässt sich dieser Vorwurf klar widerlegen. Eine gewöhnliche Hausfrau wird seit 1721 zur Fasnacht für ihre «tragende Rolle» in ihrer Familie verehrt. Margarethe Schell war in der ganzen Stadt bekannt, weil sie regelmäßig ihren betrunkenen Ehemann aus der Beiz abholen und nach Hause tragen musste. Dessen Trinkgefährten schafften es immerhin, sie zu begleiten. Heute, zur Fasnacht trägt Greth Schell zwar keinen Mann mehr durch die Gassen, dafür verteilt die gute Frau Würste, Käse und Orangen an die Kinder. Von den sieben Trotteln («Löli») wird sie stets begleitet.

Herisau: Gidio Hosestoss
Kinder, die beim Fasnachtsumzug quengeln, weil ein anderes Kind ihnen ein Leckerli vor der Nase weggeschnappt hat, gibt es in Herisau sicher nicht. Dagegen haben die Appenzeller pädagogisch wertvoll vorgesorgt. Appenzeller gelten ganzjährig als besonders humorvoll. Weil sie ihren Humor zur Fasnacht nur schwerlich übertreffen können, veranstalten sie einen Trauerzug. Damit gedenken sie dem armen Gidio Hosestoss, der einem anderen Bueb ein Leckerli gestohlen haben und daran qualvoll erstickt sein soll. Bei der obligatorischen «Trauerrede» spart der «Gidiopfarrer» auch nicht an mahnenden Worten. Vor allem der Lokalpolitik widmet er so manchen bissigen Kommentar.

Lötschental: Tschäggättä
Die Walliser gelten als recht eigenartig. Die Lötschentaler sind sogar für Walliser Maßstäbe besonders eigenartig. Die Junggesellen der Dörfer verkleiden sich mit Fellen und schaurigen Masken als teuflische Dämonen. So stürmen sie mit tosendem Glockenlärm durch die verschneiten Gassen und nehmen jeden in den Schwitzkasten, den sie zu fassen bekommen und reiben ihm Schnee ins Gesicht. Auf diese Weise versuchten sie einst, die Dame ihres Herzens für sich zu gewinnen. Sie einfach zum Tanz aufzufordern, war ihnen wohl zu «üsserschwiizerisch».

Le Noirmont: Der Ausgang der Wilden
Noch näher an der Grenze zu Frankreich, im Jura, werden die Sitten und der Umgang mit der Damenwelt immer barbarischer. Beim «Sortie des Sauvages» verkleiden sich die Männer ebenfalls als teuflische Gestalten der Wälder, verzichten aber auf aufwendige Maskenschnitzerei und malen sich die Gesichter schlicht schwarz an. Bekommen sie eine Dame beim Sturm auf das Dorf zu fassen, wird sie nicht einfach mit Schnee eingerieben, sondern gleich entführt und im Dorfbrunnen deponiert.
Tessin: Rabadan
An der Grenze zu Italien besinnt man sich wieder dem ursprünglichen Sinn der Fasnacht: Für die bevorstehende Fastenzeit schlägt man gemeinsam über die Stränge, genießt guten Vino und schlemmt sich einen Vorrat mit regionalen Spezialitäten an, damit man bis Ostern idealerweise gar nicht mehr essen und trinken mag. In Locarno, Ascona und Bellinzona beispielsweise werden auf den Piazza tonnenweise Risotto in großen Kesseln gekocht und gemeinsam verspeist. Auch Luganighe, die berühmten Tessiner Bratwürste, werden gegrillt.

Solothurn: Honolulu
Um die «Einnahme» der Stadt zu unterstreichen, wird sie mancherorts von den Narren gleich umbenannt. Die niederländische Stadt Eindhoven wird beispielsweise zum «Carnaval» in «Lampegat» (dt.: «Lampenkaff», eine Anspielung auf eine große, ehemalige Glühbirnenfabrik in der Stadt) umbenannt. Die weltoffenen Solothurner hingegen begnügen sich nicht mit Bezügen auf ihre Stadtgeschichte. Seit 1853 nennen die Narren ihre Stadt «Honolulu», weil zur Fasnacht schließlich die Welt auf dem Kopf steht und Honolulu der geografische Gegenpol der Stadt Solothurn auf dem Globus sein soll. Hawaii-Feeling mit Ukulelen und Strand-Parties mit Coconut-Cocktails im Sonnenschein wird man nur leider auch zur Fasnacht nicht am Jurasüdfuß finden - «Honolulu» hin oder her!
Basel: «Die drey scheenschte Dääg»
Während anderenorts schon längst gefastet und ausgenüchtert wird, geht es in Basel erst richtig los. Die Basler Fasnacht, seit 2017 immaterielles UNESCO Weltkulturerbe, beginnt nämlich erst am Montag nach Aschermittwoch mit dem «Morgestraich». Mit der Reformation wurde 1529 in Basel auch die Fastenzeit abgeschafft, die Fasnacht wurde trotzdem gerne gefeiert. Kirche und Regierung versuchten vergeblich, die «unsittlichen» Bürger zu zügeln und die Fasnacht zu verbieten. Um der Fasnacht irgendwie einen Sinn zu verleihen und vor der Obrigkeit zu rechtfertigen, wählten die Narren einfach militärische Hintergründe aus, die noch heute in vielen Basler Fasnachtsbräuchen erkennbar sind.