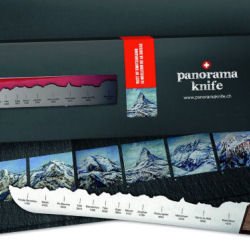Hornussen - Der dritte Schweizer Nationalsport

Mit einer 3 Meter langen Rute macht sich der erste Hornusser auf zum Abschussplatz. 100 Meter liegen zwischen ihm und seinem Ziel, dem Spielfeld. Er tritt bis zur Abschussvorrichtung vor, wo der Setzer den «Nouss» in Position bringt, wartet auf die Freigabe und holt weit zum Schlag aus. Der flexible «Stecken» gleitet im Bruchteil einer Sekunde über den «Bock», zielgenau trifft der Hornusser mit dem «Träf» vorne am Stecken den Nouss und lässt ihn möglichst weit in das «Ries» fliegen, wo die gegnerische Mannschaft mit Holzbrettern bewaffnet versucht, den Nouss abzufangen: Das ist «Hornussen». Was heute als Nationalsport gilt, trieb jedoch zu früheren Zeiten der Regierung die Sorgenfalten in die Stirn.
Hornussen als Nationalsport? Um Gottes Willen nein!
Schwingen und Steinstoßen sind zwei der drei großen Schweizer Nationalsportarten. Die dritte ist das «Hornussen». Drei bis vier Stunden stehen die Hornusser auf dem Feld und kämpfen sowohl für ihre Einzelwertung als auch für ihre Mannschaft. Das «Hornussen» ist in der Vorstellung vieler Menschen ein uraltes und schweiztypisches Spiel. Uralt ist es tatsächlich und seine Urform wird im Oberwallis als «Gilihüsine» noch heute gespielt, doch Schweizerisches Nationalspiel ist es erst seit dem 19. Jahrhundert. Vor Beginn des 19. Jahrhunderts war das Hornussen alles andere als beliebt – zumindest bei der Berner Obrigkeit. So erließ die bernische Regierung regelmäßig Vorschriften, wie die «Bernische Verordnung wider das Spielen, Schwingen und Hornussen». Doch was ist an einem Spiel so aufsehenerregend, dass die Stadtregierung sich dem entgegenstellt?
Erstmals gerügt wurde das Hornussen 1625. Kritisiert wurde seitens der Obrigkeit das sonntägliche Spielen. Im religiösen Bern fürchtete die Elite, die Untertanen würden ihren Sonntag lieber auf dem Spielfeld als in der Kirche verbringen. Derzeit war Religion wohlgemerkt ein wichtiges politisches Instrument, um die öffentliche Ordnung und Gehorsam der Untertanen zu wahren. Zudem waren es vorwiegend junge Bauern, die sich beim Hornussen austobten. So floss natürlich einiges an Alkohol und wo Alkohol fließt, da sind auch Übermut und eine gewisse Streitfreude oftmals nicht weit. Differenzen zwischen den Teilnehmern wurden nicht selten nach dem Spiel in angeschwipsten Raufereien ausgefochten. Folglich untersagte die Bernischen Regierung das sonntägliche Spielen, was im Prinzip einem generellen Spielverbot gleichte. An den anderen Wochentagen musste schließlich gearbeitet werden; vom frühen morgen bis zum späten Abend.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich das Hornussen zum Nationalsport. Der radikale Imagewandel geht auf die Verbreitung der Idee des Nationalstaates in Europa zurück. Die Länder, beziehungsweise eher die politischen und kulturellen Eliten, definierten ihre Nationen über «typische» Traditionen und Eigenarten. Oftmals bediente man sich dazu lokaler und regionaler Bräuche, welche man als nationale Bräuche darstellte. Diese Bräuche kamen zumeist aus den ländlicheren Regionen, weil sie meist die schwere Arbeit der armen Bauern, beispielsweise bei Alpabzügen oder der Chästeilet vorbildlich thematisierten. Dennoch waren es vorwiegend die Einwohner der Städte, welche das Hornussen als Nationalsport verbreiteten.
Schweiztypisch ist die Sportart übrigens nie gewesen. Viel mehr waren das Hornussen und ähnliche Spiele im mittelalterlichen Europa weit verbreitet. Heute spielen außerhalb der Schweiz nur noch zwei Gemeinden in Deutschland und ein paar Vereine in Südafrika die Schweizer Variante des Hornussen. Dort nennen sie es «Swiss Golf».
Der Eidgenössische Hornusserverband wurde 1902 in Burgdorf mit zunächst 24 Gesellschaften gegründet. 2011 zählte er über 170 Vereine. Obwohl Hornussen lange als Männersport galt, sind Frauen heute gleichberechtigt integriert. Es gibt also sowohl reine Frauenmannschaften als auch gemischte. Etwa 6.000 aktive Spieler sind registriert, darunter rund 1.300 Nachwuchsspieler unter 16 Jahren.

«Hornussen» - Das Spiel
Seinen Namen verdankt das Spiel dem sogenannten «Nouss», einem nur 78g leichten Kunststoffpuck, der beim Abschlag auf bis zu 300km/h beschleunigt wird und ein auffällig sirrendes Geräusch erzeugt. Dieses «Hornussen» gab dem Spiel seinen Namen. Mit einem flexiblen Abschlagstock, heute meist einem Carbonstab von bis zu drei Metern Länge, wird der Nouss von der Abschussrampe, dem sogenannten «Bock», ins Feld, das «Ries», geschlagen. Dort warten die «Abtuer», also die Verteidiger der gegnerischen Mannschaft, die versuchen, den fliegenden Nouss mit einer «Schindel», einem Holzbrett an einem Stiel, noch in der Luft zu stoppen, bevor er den Boden berührt. Die ursprünglichen Varianten des Hornussens waren quasi Kriegssimulationen. Deswegen wurden Kopf- und Körpertreffer am Verteidiger besonders gewertet. Die Schindel hatte in diesen Varianten noch eine Schild- und Schutzfunktion.






Das Spiel ist eine Kombination aus Einzel- und Mannschaftsleistung: Das präzise Abschlagen ist Einzelleistung, das Abtun Teamarbeit. Die «Schläger» erkämpfen sich Punkte, indem sie den Nouss für die Abtuer unerreichbar ins Feld schlagen. Je weiter der Nouss dabei im Feld landet, desto mehr Punkte erhält die schlagende Mannschaft. Der Schlagweitenrekord liegt bei 390 Metern. Ab 100 Metern Weite erhält man Punkte: Je zehn Meter ein Punkt. Aber das alleine bringt noch keinen Sieg. Entscheidend ist, wie oft die gegnerische Mannschaft das Abtun nicht schafft. Jedes verpasste Abtun ergibt eine sogenannte «Nummer». Wer weniger Nummern kassiert, gewinnt. So kann ein Team mit kürzeren Schlägen gewinnen, wenn es beim Abtun besser arbeitet.
Pro Partie treten zwei Mannschaften mit je 18 Spielern in zwei Durchgängen gegeneinander an. Jede Mannschaft muss pro Durchgang jeweils einmal schlagen und einmal abtun. Die Spieldauer liegt bei etwa drei bis vier Stunden. An großen Hornusserfesten, etwa dem Eidgenössischen Hornusserfest, welches alle drei Jahre stattfindet, wird sogar in vier Runden gespielt.
Drei bis vier Stunden? Viel zu lang für eine Live-Übertragung im TV!
Trotz seiner Dynamik ist das Hornussen medial bislang unterrepräsentiert. Das Publikum besteht meist aus Angehörigen und selbst Aktiven. In den letzten Jahren gab es mit dem Nachthornussen und veränderten Spielformen Versuche, das Spiel für das Publikum attraktiver zu gestalten. Was das Hornussen besonders macht, ist seine Mischung aus uralter Tradition, physischer Herausforderung und Teamgeist. Es ist ein Spiel, bei dem Kraft, Technik und Reaktion gefragt sind und bei dem selbst High-Tech-Helme mit Vollvisier zum Einsatz kommen, denn ein Nouss in voller Geschwindigkeit ist nicht nur laut, sondern auch gefährlich. Präzision, Koordination sowie eine ordentliche Portion Mut sind gefordert, wenn der Nouss mit bis zu 300km/h auf einen zugeschossen kommt. So bleibt das Hornussen ein faszinierender Sport zwischen bäuerlichem Erbe und moderner Wettkampfkultur.