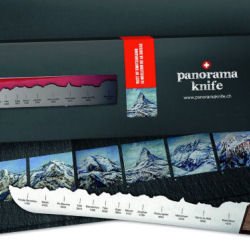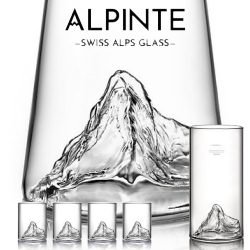Die große Schlacht der Ei-genossen - Ostern in Bern und Zürich

"Man spielt nicht mit Essen!" - Jedes Kind wächst mit dieser Benimmregel auf. Das Leben wäre aber nur halb so lustig, wenn es nicht die Ausnahmen gäbe, die eine Regel bestätigen. Für diese Benimmregel ist entsprechende Ausnahme zu Ostern gültig. Alle Kinder lieben das "Eiertitschen" beim Osterfrühstück. Jeder hat ein buntes Osterei und duelliert sich reihum mit der Familie, indem man die Eier gegeneinander schlägt. Das Ei, das am längsten unbeschädigt bleibt, gewinnt. Es werden Taktiken entwickelt, wie man das Ei festhalten muss, in welchem Winkel man schlagen muss, mit welcher Seite des Eis man schlagen muss, oder mit welcher Farbe man es anmalt, damit die Schale zusätzlich stabilisiert wird und nicht bricht. Die älteren Generationen sind darin logischerweise, dank jahrzehntelanger Erfahrung, im Vorteil. Umso frustrierender ist es, wenn diese Erfahrungen und Taktiken beim Eiertitsch plötzlich nicht mehr helfen, ein winziger Riss die Schale durchzieht und der kleine Dreikäsehoch von Gegner in hämisches Gelächter verfällt. Wenn Ihnen diese Situation bekannt ist, dann sollten Sie niemals gegen einen Schweizer das Ei erheben! Besonders von Bernern und Zürchern sollten Sie Ihre Ostereier fernhalten, denn in Bern und Zürich hat man die edle Fehde mit dem farbigen Federviehgelege perfektioniert und zum massentauglichen Osterfestvolkssport weiterentwickelt. Um beim Eiertitschen "obenaus zu schwingen" wie ein Schweizer, sollten Sie jetzt aufmerksam weiterlesen und von den alten "Eigenossen" lernen.
Eiertütschete in Bern
In Bern sagt man nicht "Eiertitschen", man sagt "Eiertütsche". Am Ostersonntagmorgen bereiten sich die Stadtberner auf die große Schlacht vor. Vorsichtig wird das Osternest mit Munition geladen und jedes Ei mit äußerster Vorsicht behandelt, um nicht schon durch winzige Haarrisse den Zweikampf im Voraus zu entscheiden. Zusätzlich zum Eierkörbli klemmen sie sich noch ein Paket fertig gefärbter Eier aus dem Supermarkt unter den Arm, welche sie "Touristeneier" nennen, stecken sich einen Aromat-Streuer in die Jackentasche und dann verlassen sie sanften Schrittes das Haus. Pünktlich, um zehn Uhr morgens, beginnt die große "Eiertütschete" auf dem Kornhausplatz, im Schatten des Kindlifressers, unter den Lauben des Kornhauses. Eine alte Zeichnung des Berner Malers Hans Eggimann aus dem Jahre 1892 belegt, dass dieser Brauch schon vor über 100 Jahren gepflegt wurde. Seinen Ursprung hat dieser lustige Brauch wohl in der katholischen Fastenzeit. Auch Eier durften während der Fastenzeit nicht gegessen werden. Das Problem dabei: Die Hühner bedenken nicht die stark eingebrochene Nachfrage und setzen die Eierproduktion unvermindert fort, anstatt sie herunterzufahren. Diese Überproduktion hatte zur Folge, dass sich in den Haushalten der Menschen die Eierbestände inflationär erhöhten. Bis zum Osterfest, dem Ende der Fastenzeit, konservierte man die Eier, indem man sie hart kochte. Manche Eier wurden nach altem, heidnischen Brauch bemalt. Wenn man nun schon so viele Eier im Überfluss hatte, dann konnte man wenigstens noch etwas Spaß daran haben und man begann, damit herumzuspielen. Der Eiertütsch war geboren. Oder sagt man hier "geschlüpft"?


Der laaangsame Weg zum Sieg
Die Regeln bei der Eiertütschete in Bern sind im Grunde wie daheim, im Familienkreis. Jeder gegen jeden, mit dem Unterschied, dass es am Kornhausplatz um die hundert Gegner mehr hat, als in der Familie. Reihum wird mit den Eiern angestoßen. Neugierige Touristen gesellen sich gelegentlich dazu, und werden eingeladen mitzuspielen. Deshalb die fragilen "Touristeneier". Ein Organisationskomitee gibt es nicht. Nach altem Schweizer-Armee-Prinzip tütscht sich jeder milizartig selbstständig zum Schlachtfeld, dem Kornhausplatz vor. Der glorreiche Sieger eines Duells darf das besiegte Ei behalten und sich etwa eine Woche lang nur von Eiersalat ernähren.
Hochspannend ist es, die angewandten Techniken der Berner zu beobachten und zu analysieren. Dabei lernt man recht schnell, denn Berner sind bekanntlich seeehr laaangsaaam und man hat genügend Zeit, sich die perfektionierten Tütschbewegungen einzuprägen. Ein herkömmliches Ei hat drei Angriffsseiten. Die stärkste Seite ist die "Spitz". Dort hat das Ei die kleinste Trefferfläche und härteste Schale, die imstande ist, der Wucht des Aufpralls zu widerstehen. Manche setzen allerdings auch auf das "Füdli" (hochd.: "Popo"), wo sich meistens die Luftblase unter der Schale befindet. Wenn das Ei dort zum Kochen angestochen wurde, ist die Bruchgefahr entsprechend größer. Ein alter Irrtum ist es allerdings, dass das Ei härter wird, wenn man es länger kocht. Je länger die Garzeit, desto schwächer wird die Haut, die die Schale von innen zusammenhält und an das Ei bindet.
Manche versuchen, das Ei so weit wie möglich beim Tütsch mit der Hand zu umschließen, um die Schale zu stabilisieren, manche versuchen den Griff kurz vor dem Aufprall zu lockern, andere wiederum versuchen bei "Spitz gäge Spitz", das gegnerische Ei seitlich neben der Spitze zu treffen. Welche Technik die Beste ist, hängt immer vom Ei ab. Ein wohlgeübter Blick vermag, das Ei präzis auf Stärken und Schwächen zu analysieren. Je kleiner das Ei, desto stärker ist es, denn diese werden von jungen Hühnern gelegt und haben einen hohen Calciumgehalt in der Schale. Wer eigene Hühner besitzt, sollte sie in der Zeit vor Ostern am besten noch mit einer Extraportion Muschelkalk füttern, welcher reich an Calcium ist.
Wie in jeder Sportart, gibt es natürlich auch bei der Eiertütschete schwarze Schafe, die "bschysse". Gelegentlich taucht irgendwo ein falsches Ei aus Holz auf oder auch Enteneier, welche etwa die Größe eines Hühnereis haben, aber deutlich härter sind. Wer noch immer glaubt, man müsse einfach nur möglichst schnell tütsche, der sollte sich besser einen anderen Ostersport suchen. Wäre dem so, dann wären die langsamen, gefühlvollen Berner sicher nicht die Großmeister des Eiertütsche, oder?


Zwänzgerle in Zürich - Warum die Zürcher so reich sind
Gottlob, es gibt einen alternativen Ostersport! Während in Bern am Ostersonntag die Eier tütsche, klimpert es in Zürich am Ostermontagmorgen um Zehn am Limmatquai auf dem Rüdenplatz. Seit über 200 Jahren praktiziert man in Zürich das "Zwänzgerle". Im Gegensatz zu den Bernern, wo jeder gegen jeden tütscht, treten in Zürich ausschließlich Erwachsene gegen Kinder an, um sie ihrer Ostereier zu berauben. Das Vorurteil, die Zürcher seien reich und werfen mit Geld um sich, stimmt. Anstatt ebenfalls mit einem Ei gegen die Kinder anzutreten, werfen sie 20-Rappen-Münzen ("Zwänzger") auf die Eier der Kinder. Dazu müssen die Kinder den Erwachsenen ihr Osterei mit der Hand still hinhalten. Dass schlecht gezielte Münzwürfe mitunter recht schmerzhaft auf den zarten Kinderhänden sein können, haben einige Kinder bereits gelernt und sich mit einem dicken Skihandschuh ausgerüstet. Bleibt das Zwänzgerli in der Eierschale stecken, so bekommen die Erwachsenen das Ei. Gelingt es ihnen nicht und das Zwänzgerli prallt vom Ei ab, so dürfen die Kinder das Ei und auch das Zwänzgerli behalten. Da Zürcher sehr reich sind und extra rollenweise Zwänzgerli von der Bank abheben, dauert das Spektakel oft mehrere Stunden lang. Mit Kleingeld haben sie wenig Erfahrung und daher auch wenig Gelegenheit, das "Driirüere" (hochd.: "Reinwerfen") zu trainieren. Das Zwänzgerli geschickt im Ei zu versenken, ist vorstellbar schwierig und der Gewinn der Kinder entsprechend hoch. So werden Zürcher schon als Kind reich.