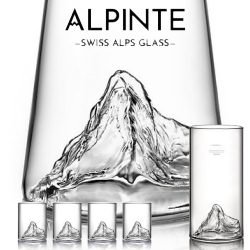Schwyzerdütsch – Lektion 3
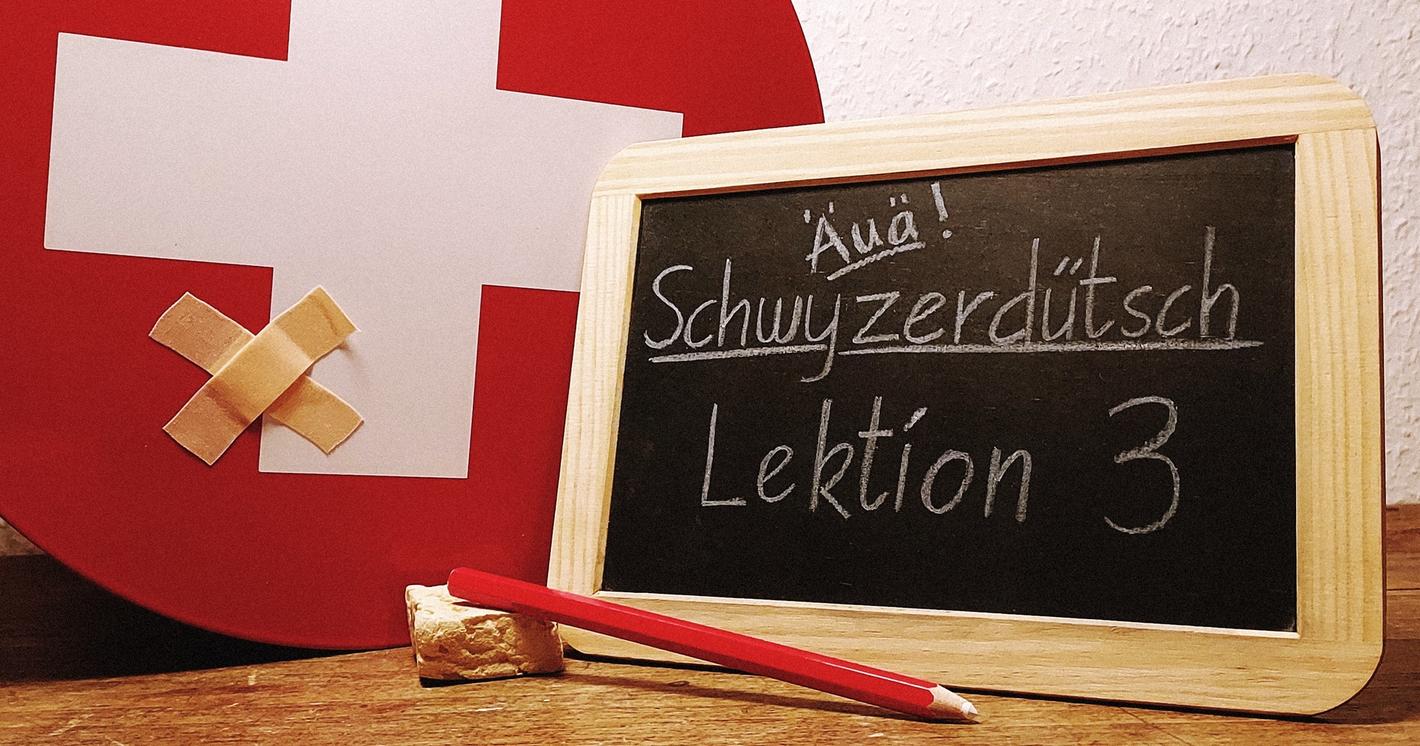
"Äuä!" - Für was kompliziert, wenn es auch einfach geht?
Zugegeben, in unserer letzten Lektion haben wir uns ordentlich die Zunge verdreht und den Rachen ramponiert. Die häufigste Leserreaktion auf die Lektion 2 war: "Aua!" Seien Sie versichert: Durch regelmäßige Übungen, lässt der Rachenschmerz mit der Zeit nach. Außerdem ist Schwyzerdütsch gar nicht so schwer, wie die letzte Lektion vermuten ließ. In Tat und Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Die Schweizer sind in der Regel ein sehr gemütliches Volk, das es versteht, sich das Leben zu erleichtern. Für was kompliziert, wenn es auch einfach geht? Diese entspannte Lebensphilosophie fangt schon beim Sprechen an.
Sie wohnen nun schon ein paar Monate in Bern. Die Ausdrucksweise und Pragmatik der Einheimischen sind Ihnen mittlerweile recht geläufig. Auch das harte "Ch" überstehen Sie schon fast ohne Mandelentzündung. Doch es nimmt sie immer noch Wunder, warum gefühlt in jedem zweiten Wort ein "U" zu hören ist. Die Antwort ist ganz einfach: Weil es einfacher ist. Es ist einfacher, Vokale zu sprechen, als Konsonanten. Nahezu jeder dürfte schon das ein oder andere Mal, wenn auch eher unterbewusst, diese Erfahrung gemacht haben. Eines der ersten Anzeichen nämlich, dass man ein Glas Wein zu viel hatte, macht sich in der Aussprache bemerkbar. Man beginnt zu lallen. Doch dieses Lallen ist nichts anderes als eine alkoholbedingt zwängsläufige Vereinfachung der Aussprache, in der Konsonanten häufig ausfallen oder verstümmelt werden. Der Vorteil, auch im geistesgegenwärtigen Zustand Konsonanten gegen Vokale auszutauschen, liegt also offensichtlich darin, dass einem ein weinseliger Zustand erst deutlich später angemerkt wird.
Ein klassisches Beispiel ist das "U" als Ersatz für das "L". Man spricht von der "l-Vokalisierung". Vom Aargau über Solothurn, Bern und Luzern bis zur französischen Sprachgrenze bei Fribourg macht sich diese Praxis bemerkbar. Auch im oberwalliser Goms vokalisiert man im Walliserdütsch. Doch Vorsicht! Nicht jedes beliebige "l" kann durch ein "u" ersetzt werden. Ein "l", das auf einen Konsonanten folgt, bleibt auch immer ein "l". Aus einer "Pflanze" wird also niemals eine "Pfuanze"! Auch bei Namen wird nicht einfach getauscht. Es wäre doch recht verwirrend, bei Audi den Wocheneinkauf zu tätigen, anstatt beim Aldi. Wenn ein Vorname allerdings schon in eine Koseform geändert wurde, dann darf getauscht werden. So wird zum Beispiel aus dem "Frederik" zunächst ein "Fredel" und schließlich ein "Fredu". Ansonsten darf man nur in folgenden Fällen das "l" vokalisieren:
- wenn das "l" nach einem Vokal steht und auf das "l" ein Konsonant folgt
- wenn das "l" nach einem Vokal am Wortende steht
- doppel-l ("ll") werden immer vokalisiert
Betrachten wir das ganze also in unserem Übungstext und sprechen jedes "u" als solches deutlich hörbar aus. Ein geschriebenes "eu" klingt also nicht wie in "Feuer". Sowohl das "e" als auch das "u" werden beide deutlich, mit fließendem Übergang ausgesprochen. Das gilt auch für alle anderen Vokale, denen ein "u" folgt. Stören Sie sich einfach nicht weiter daran, dass auch gelegentlich ein "e" durch ein "ä" oder "ö" ersetzt wird. Ebenso ein "i" durch "ö", "o" durch "ö", "a" durch "o" oder "ö", "eu" durch "üü", "au" durch "uu" und ein "ei" durch "y" (lang gesprochenes "ii"). Das dient rein der Bequemlichkeit.
Bonusaufgabe: Häufig stößt man in Bern auch auf das Wort "äuä", das sich vokalisiert von "allwäg" ableitet. Was es bedeutet, erkennt man nur am Kontext. Finden Sie es auch heraus?
Situation 1: Siuberbsteck im "Löie"
Sie möchten Ihre nette Nachbarin beydrucke und lade sie zum Ässe in den Gasthof "Löwen" y. Der "Löie" ist zwar nicht besonders vornehm, dafür ist er tüür genug, was man schon am Siuberbsteck auf dem Tisch erkennt. Außerdem bietet die Speisekarte reichlich Auswahl. Ihre Nachbarin bemerkt: "Da weiß man ja gar nid was man söu bsteue!" Auch Ihnen bietet die Karte zu viu Lesestoff. Deshalb machen Sie es sich bequem und fragen die Serviertochter: "Könnte ich bitte die Wiudcharte haben?" Die wird bestimmt weniger lang sein. Die Serviertochter entschoudigt: "Äxgüsi, es hat leider kein Wiud mehr. Rüedu, unser Jäger hatte einen Jagdunfau und liegt im Spitau. Ein Wouf hat ihn grad mit der Chraue verwütscht wo är hett ihm e Faue wöue steue." Sie bringen Ihr Beduure zum Uusdruck und bsteue einfach "Ein Chaubsplätzli Wiener Art mit Pommes Frites, bitte." Ihre Nachbarin hat sich inzwischen auch entschlossen: "I nehme bitte das Châteaubriand Café de Paris und zur Vorspys die Jakobsmuschle Bordelaise!" Als Sie das hören verschlägt es Ihnen glatt den Schnuuf. Bym Italiener eine Pizza bsteue, wäre biuiger gewesen. Zur Vorspys haut einen Bratöpfu. Das hätte auch gelangt. Sie wöue noch schnäu Ihr Chaubsplätzli gäge einen haube Güggu ytuusche, aber da kommt schon die Serviertochter mit Ihrem Täuer und der Koch persönlich mit der Vorspys Ihrer Nachbarin. Diese luegt verwirrt auf ihren Täuer und fragt: "Was isch das für e Piuz?" Sie klären sie auf: "Das sy Jakobsmuschle u kei Piuzli. Schmöckt's?" - "Äuä, aber es fäut Sauz! Hesch o zwenig Sauz?" - "Äuä, mein Chaub isch vöuig versauze u chaut! Das nächschte Mau gehen wir ins "Marco Polo"." Der Vorschlag scheint ihr zu gefallen: "Äuä! Schön, wir haben äuä die glychlige Wäuelänge!" Sie können ihre Feststeuig zwar nicht bestätigen, möchten sie aber nicht kränken und antworten mit versteckter Ironie: "Äuä."
Situation 2: Ämmitauer Esumiuch
An einem schönen Wochenende im Januar besuchen Sie Ihren Freund Christian in Langnau im Ämmitau. Ändlech hat es gschneit und aui Hügu sehen uus wie mit Zuckerstoub puderet. Zum Schlittle längts zwar no nid, aber es isch schön für Härz u Seeu. Der Himmu isch blou, e chlyni Vogu flügt stiu über das Fäud und man vergisst den Autag und die ganze Wäut. Chrigu nimmt Sie mit zu seinem Freund Andreas. Ändu isch Buur. Beide bemühen sich sehr, so deutlich wie möglich mit Ihnen zu sprechen und ihren Emmentaler Dialekt so gut es geht abzusteue. Das gelingt ihnen so mittumässig gut. Die frische Miuch söue Sie unbedingt probieren. "Scho syne Eutere haben den besten Chäs gemacht!", erklärt Chrigu. Ämmitauer machen es sich beim Sprechen besonders leicht. Um Missverständnisse zu vermeiden, fragen Sie lieber nach: "Seine Euter? Du meinst äuä die Euter seiner Kühe." Chrigu kichert amüsiert: "Nei, syne Euuutere! ...Vatter u Mueter." Da faut Ihnen säuber wieder y, dass die Sprache Ihnen doch noch so manche Stouperfaue steut. Bym Ändu erwartet Sie schon ein voues Gläsli frischer, warmer Miuch. So eine leckere Miuch haben Sie noch nie getrunken und Sie gratulieren Ändu: "Die Miuch isch geniau! Tip top! Dyni Chüe müssen äuä die glücklichsten Chüe vo der Wäut sy!" Ändu aber antwortet nur mit ernster Miene: "Chüe? Die Miuch isch vo mym Esu!" Vor Schreck steue Sie das Gläsli ab und fassen sich an den Haus. "Vom Esu??", fragen Sie verwirrt und leicht angewidert. Ändu und Chrigu sehen sich kurz an und bestätigen dann nickend, als sei es im Ämmitau vöuig normau, Miuch vom Esu zu trinken. Dennoch haben Sie Ihre Zwyfu, ob Sie das glauben können. Ändu putzt sich noch kurz seine Brüue, setzt sie wieder auf die Nase und führt Sie über seinen Hof, der schon mehrere hundert Jahre aut ist. Aute, vergiubte Biuder vom Läbe im Ämmitau hangen an der Wand in der warmen Stube, dusse spiut e Sennehund mit sym Bau und bäuet heiter. "Im Chäuer unde gibt es nüt zu sehen.", sagt Ändu, "Da isch es dunku." So ernst, wie Ändu das sagt, glauben Sie immer weniger an den Esu. Sie fragen noch einmal scherzhaft nach: "Wäre es häu im Chäuer, könnte man dann dort den Esu sehen?" Immer noch völlig ausdruckslos antwortet Ändu: "Esu? Was für en Esu?" Erst dann beginnen Ändu und Chrigu vermöukt zu pfupfen. Immerhin dreht sich Chrigu achselzuckend und lachend zu Ihnen um: "'tschoudigung, so sy mir Ämmitauer haut." Ändu pflichtet ihm bei: "Das isch äuä eso gsy! Scho myni Mueter hat gesagt ich bin dem Tüüfu ab em Charre gheit." Aus Entschoudigung füut Ändu Ihnen nochmals das Glas mit warmer Miuch und bietet Ihnen einen Platz in seinem gemütlichen Sässu an. Baud scho wird es dunku und Zyt die Sägu zu setzen.
Ist das nicht fantastisch, wie einfach man sich das Sprechen machen kann, ohne missverstanden zu werden? Wenn Sie nicht alles verstanden haben sollten, ist das wenig schlimm. Übung macht den Schweizer. Sollten Sie doch alles verstanden haben, dann haben Sie sich einen Nobäuprys verdient! Im Fau, dass Sie lieber andere Regionen der Schweiz als das Berner Mittelland, den Oberaargau, das Emmental, Luzern, das Entlebuch oder das Goms im Oberwallis besuchen wollen, kann Ihnen die l-Vokalisierung vöuig egau sy. Aber ein anderer Blickwinku schadet äuä nüt.