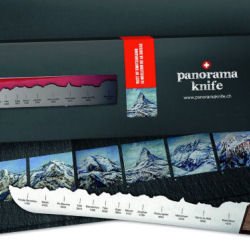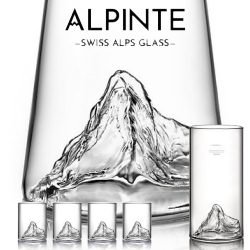Schwyzerdütsch – Lektion 6

In den ersten fünf Lektionen haben wir bereits die wichtigsten Grundlagen zum Verständnis schweizerdeutscher Dialekte gelernt. Wir wissen nun, dass Grammatik und Pragmatik oft deutlich vom Hochdeutschen abweichen (Lektion 1), die korrekte Aussprache der harten "ch"-Laute haben wir bis zur Mandelentzündig geübt (Lektion 2), die wir mit einer leichten Übung zur l-Vokalisierung (Lektion 3) auskuriert haben. Außerdem haben wir gelernt, wann man das Diminutivsuffix "-li" verwenden kann (Lektiönli 4) und welche Missverständnisse auftreten können, wenn Schweizer sich bemühen, hochdeutsch zu sprechen und man sich selbst nicht bemüht, sie zu verstehen (Lektion 5).
In den schweizerdeutschen Dialekten verbergen sich viele sogenannte "fautsche Fründe", die wegen ihrer Ähnlichkeit zu bekannten Ausdrücken meist zu falschen Übersetzungen verleiten. Wir bewegen uns in unseren Lektionen meist innerhalb des Berner Dialektraumes. Selbst dort ist eine Vereinheitlichung kaum möglich, wenn man beispielsweise die Unterschiede zwischen Stadtberner, Emmentaler und Oberländer Dialekten betrachtet. Mit etwas Übung und Erfahrung lassen sich die gehörten Dialekte gut ihrer Herkunftsregion zuordnen. Wenn Ausländer so weit gelernt haben, fühlen sie sich sicher und trauen sich zur Freude der Schweizer eher zu, schweizerdeutsch zu sprechen. Während dieser Lernphase tritt jedoch die größte Gefahr auf, das bislang Gelernte zu verwerfen und den Dialektdienst künftig zu verweigern. Es werden weitere fautsche Fründe auftreten, die sich kaum einer bestimmten Region zuordnen, geschweige denn eindeutig Übersetzen lassen. Selbst ein Dialog unter Schweizern wie in vorherigen Lektionen wäre hier als Übungstext zu unserem Beispielwort nicht möglich. Er begänne etwa so:
Schweizer A: "Bei uns sagt man dem so: ..."
Schweizer B: "Nein, hier sagt man dem so: ..."
Schweizer C: "So so. Also bei uns sagt man dem aber so: ..."
Schweizer D: "Was redet dir für en Seich! Man sagt dem so: ..."
Diverse weitere Schweizer aus wiederum anderen Teilen der Deutschschweiz werden sich einmischen, protestieren und ihre Version des Ausdrucks anpreisen bis erste Beleidigungen und schließlich Fäuste fliegen. Um des Friedens willen, werden wir einfach niemanden zu Wort kommen lassen. Immerhin zeigt dieses Beispiel, dass diese "fautsche Fründe" kein Grund sein sollten, die Flinte ins Korn zu werfen, wenn selbst Schweizer sich darüber nicht einig sind, in welcher Region man ein Dialektwort verwendet. Unser Beispiel in dieser Lektion isch so en dermasse gschpässige fautsche Fründ, dass man grad einen Vogel bekommen könnte. In einer solchen Situation, wo man an seinen eigenen Fähigkeiten und seinem Verstand beginnt zu zweifeln, helfen nur ein dickes Fäu oder e...
Vogelschüüchi
Sie haben es wahrscheinlich richtig erraten oder gewusst: dabei handelt es sich um eine Vogelscheuche. In der gesamten Deutschschweiz ist dieses Wort bekannt. Doch vielerorts gibt es für die Vogelscheuche auch noch ganz andere Ausdrücke. Dabei kommt es nicht selten vor, dass gleich mehrere der folgenden Wörter in ein und demselben Ort verwendet werden und gleichzeitig auch noch an vielen anderen Orten der Schweiz. Sie lassen sich kaum einer bestimmten Dialektregion zuordnen.
Oft wird zunächst der "Vogel-" einfach ausgelassen und nur die "Schüüchi" genannt. In manchen Regionen ist es eher üblich, anstelle eines ausgedehnten "ü" lieber ein langes "i" zu sprechen. Die "Schiichi" ist daher noch halbwegs nachvollziehbar. In anderen Regionen vermeidet man lieber lange "i"- oder "ü"-Laute und bleibt bei "Scheuch" oder "Scheych". Letzteres lässt sich immerhin für den Raum Bern ausschließen, denn dort wäre es ein Bein anstelle einer Vogelscheuche.
Aus einer "Scheuche" ein "Gescheuch" zu machen, ist noch wenig abwegig. So wird auch das "Gschüüch" oder auch das "Gschüücht" recht häufig verwendet. In einigen Regionen reicht es aber meist, nur den Wortanfang deutlich zu sprechen und am Ende zu improvisieren: "Gschüw" oder "Gschüwete" werden daraus. Diese abstrakte Wortakrobatik beherrschen gewöhnlich die Walliser. Im Ober- und Mittelwallis verwendet man aber auch die Ausdrücke "Boot", "Booze", "Boozi" oder "Boozu". Der wortverwandte "Butz" oder "Butzemaa" wird aber auch auf vielen Feldern im Raum Appenzell, St. Gallen und Graubünden aufgestellt. Andere Oberwalliser stellen lieber einen "Mätz" auf.
Da Vogelscheuchen meist aus Stroh gebastelt wurden, ist der "Böögg" ein naheliegender Begriff. In der Stadt Zürich jedoch wird er kaum verwendet. Wahrscheinlich weil es dort mehr Banken als Felder hat. Im ländlichen Umfeld der Stadt stellt man einen "Böögg" häufiger auf, aber auch überall in der Nordschweiz findet man den ein oder anderen "Böögg" auf den Feldern. Weil das aber wiederum viel zu einfach wäre, macht man daraus auch noch einen "Bröögg", einen "Booggu" oder einen "Booggi". Kommen Sie noch nach? Gut! Dann wollen wir auch den "Bööli", den "Booli" und den "Pooli" nicht unerwähnt lassen.
Tief in den Hochalpen, östlich des Gotthards findet man einen weiteren Begriff für den traditionellen Agrarschädlingsbekämpfer: "Lööli". Der Berner wird sich hier wahrscheinlich auch fragen, warum man ein Feldarbeitswerkzeug als Trottel beschimpft. Im östlichen Appenzell ist der "Lööli", oder "Leeli", zum Teil auch bekannt.
Im Berner Oberland trifft man häufig auf einen "Toggel" oder, gemäß Lektion 3 mit vokalisiertem "l", einen "Toggu" in weiteren Gemeinden des Kantons bis hinauf ins Seeland. Weniger große "Toggeli" findet man eher in kleinen Gärten. Auch "Töggle" oder "Töggu" gehören zur Familie. Freuen Sie sich nicht zu früh, denn dem Kanton Bern lässt sich diese Familie keineswegs eindeutig zuordnen. Auch in der Zentralschweiz bis hinauf zum Bodensee ist sie vereinzelt vertreten. Außerdem ist auch der "Haghuuri" (wörtl.: "Zaunkauz") den Ornithologen im Kanton Bern ein Dorn im Auge. Ebenso der "Stroumaa" (wörtl.: "Strohmann") und das "Poschterli" im Emmental und im Seeland.
Je mehr Ausdrücke man für die Vogelscheuche findet, desto ungeheuerlicher wird es. Apropos ungeheuerlich: "Uughüür" (wörtl.: "Ungeheuer") oder kurz "Ghüür" sind zwei weitere Begriffe.
Ebenso "Tunggel", "Tuntscheli", "Geegse" und "Gschiwätt". Ein "Schreck" wäre auch möglich, wobei sich manche einig sind, dass es eine Frau, also ein "Schreckwyb" sein muss. Der "Raabevatter" lässt immerhin noch erkennen, wen er verschreckt und leitet damit den zweiten Teil der Lektion ein.
Teil 2
a) Definition des Feindbildes
Das Aufstellen einer "Schüüchi" erfordert manchmal eine Erklärung. In diesen Fällen wird deutlich gemacht, ob man generell alle Vögel oder nur bestimmte Vogelarten verschüüche will. Dazu stellt man den oben genannten Begriffen einfach ein "Vogel-", "Raabe-", "Chrääie-", oder "Hüener-" voran.
Beispiel: "Chrääieböögg" oder "Hüenerbutz".
b) Rechtfertigung des Schutzbedürfnisses
Gelegentlich muss man auch das Verscheuchen der Vögel rechtfertigen und angeben, was man vor ihnen schützen will. Dem Landwirt genügt es meist, den oben genannten Begriffen den Acker voranzustellen.
Beispiel: "Achergschüw".
Sollte er seinen Acker gerade zufällig mit Gerste bestellt haben, ist dieses, für die Bierproduktion essenzielle Getreide, besonders wertvoll und im Interesse der Allgemeinheit schützenswert. Anstelle des Ackers zieht man also die Erwähnung der Gerste vor. Andere Nutzpflanzen lassen sich ebenso einsetzen.
Beispiel: "Gerschteposchterli".
Alle 42 aufgezählten Begriffe (sicher gibt es noch einige mehr) und deren Variationen aus Teil 2 lassen sich auf Hochdeutsch mit einem einzigen Wort übersetzen: "Vogelscheuche".
Liebe Schweizer, bitte habt Erbarmen mit allen Lernenden, die keines der Dialektwörter gleich als "Vogelschüüchi" identifizieren können.
Liebe Lernenden, bitte lasset nech nid verschüüche vo söttigi Dialektmätzli! Machet wyter, eis nach em angere u hebbet düre!