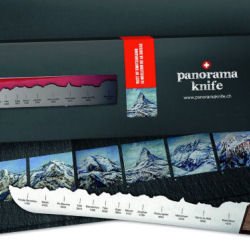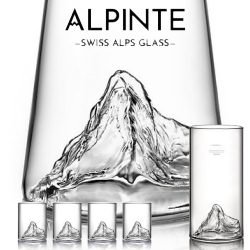Die Alpenapotheke - Von Kräuterhexen, Quacksalbern und Naturwundern

Das Leben in den Alpen ist nicht leicht. Oft ist es geprägt von schwerer, körperlicher Arbeit. Heute erleichtern zwar moderne Maschinen den Arbeitsalltag der Sennen, Alpwirte, Schreiner und Bauarbeiter, doch diese Maschinen lassen sich im steilen Gelände der Berge nur begrenzt einsetzen, sodass vieles noch mit Muskelkraft bewältigt werden muss. Wenn wir von Begriffen wie "Traditionshandwerk" sprechen oder von Arbeit, wie sie "seit Jahrhunderten" verrichtet wird, neigt man dazu, deren Bedeutung zu übersehen. Stellen Sie sich vor, wie die Menschen im Mittelalter gearbeitet haben müssen, ganz ohne Strom, Motoren und Arbeitsschutzvorschriften. Blessuren, schmerzende Muskeln, Gelenke und sogar schwere Arbeitsunfälle gehörten einfach dazu. Ganz zu schweigen von den regelmäßigen Kriegereien im "heiligen römischen Reich". Medizinische Versorgung war praktisch nicht vorhanden und die durchschnittliche Lebenserwartung von 40 Jahren entsprechend gering. Die einzige Chance, seine körperlichen Leiden zu lindern, sahen die Menschen in der Natur. Als bekanntestes Beispiel dürfte hier Hildegard von Bingen dienen, die als Benediktinerin die heilenden Kräfte der Pflanzen studierte und ihre Erkenntnisse schriftlich dokumentierte. Sie erreichte sogar ein stolzes Alter von 81 Jahren, als sie im September 1179 starb. Allerdings war sie als Äbtissin auch privilegiert und musste keine körperlich schwere Arbeit verrichten wie das einfache Volk. Dieses hatte auch weder Zeit noch Gelegenheit, Pflanzen zu suchen, anzubauen und auf heilende Wirkung zu studieren. Bereits in der Steinzeit kannte man Heilpflanzen. Mangels der Fähigkeit des Schreibens konnten die Menschen ihre Erfahrungen jedoch nicht für die Nachwelt festhalten. Mündliche Überlieferungen mit teils äußerst gefährlichem Halbwissen hielten sich folglich bis ins Mittelalter.
Alkohol – zumindest chemisch betrachtet ein Lösungsmittel
Allheilmittel dieser Zeit war der Alkohol. In den Städten war Wasser meist ungenießbar und man konnte praktisch nur Bier und Wein trinken. Das Geheimnis musste demnach in den Pflanzen versteckt sein, dem Hopfen und den Weintrauben. Ein Alkoholgehalt von 2% wurde darin allerdings selten überschritten. Die berauschende Wirkung des Alkohols war jedoch bekannt und erwünscht. Die Braumeister mussten also eine Lösung finden, um die Wirkung zu verstärken. Zufällig fanden sie diese in einer weiteren Pflanze, dem Sumpfporst. Dank seiner aromatischen ätherischen Öle verwendete man ihn bereits gegen Läuse und anderes Ungeziefer. Als Zusatz im Braukessel verstärkte er auch noch den Rausch. Seine toxische Wirkung blieb lange Zeit unentdeckt, denn die Symptome ähneln stark der typischen Alkoholvergiftung und man maß ihnen keine große Bedeutung zu. Hochprozentiges verwendete der Arzt und Philosoph Paracelsus im 16. Jahrhundert als Heilmittel mit der Erfindung seines "Branntweins". Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erfand Henriette Henriot im Kanton Neuchâtel ein Wermut-Elixir gegen "Würmer aller Art und Erkrankungen des Leibes und Gedärms". Es zeigte eine gute, krampflösende Wirkung bei Verdauungs- und Menstruationsbeschwerden und erfeute sich größter Beliebtheit. Bei der gesunden Bevölkerung wurde es wegen seines hohen Alkoholgehalts von 50% oder mehr geschätzt. Als 1905 ein Weinbauer seine Frau und seine zwei Kinder ermordete, schob man die Schuld auf dieses Elixir, dass inzwischen als "Absinthe" bekannt war und verbot es. Das Gift des Wermuts sei die Ursache. Erst weitere hundert Jahre Später widerlegte die Wissenschaft diese Behauptung und bestätigte sogar die Heilwirkung der darin enthaltenen ätherischen Pflanzenöle.

Ein Spagat zwischen Wissen und Aberglaube
Die "Forschung" der einfachen Menschen im Mittelalter wurde meist von weit verbreitetem Aberglauben sabotiert. Man hatte davon gehört, dass viele Pflanzen so manches Problem lösen, aber hatte allgemein doch nicht so rechte Kenntnis. Das rief die Quacksalber auf den Plan, die von Stadt zu Stadt reisten und auf den Marktplätzen ihre angeblichen Wundermittel anpriesen. Auch wenn sie nach dem Verkauf ihrer Waren schnell das Weite suchen mussten, bevor ihr Betrug auffiel, so brachte ihnen die Leichtgläubigkeit und die Not der Menschen gutes Geld ein. Wenn jemand gute Kenntnis von Heilpflanzen hatte, dann waren es meist Frauen. Wenn sie damit auch noch Heilung verschafften, dann wurden sie nicht selten der Hexerei beschuldigt. Umso mehr verwundert es, dass man ausgerechnet eine Pflanze verwendete, um Hexen abzuwehren. Man hing einen Hauswurz in den Kamin, damit Hexen nachts nicht durch diesen in das Haus fliegen können. Ebenso pflanzte man ihn auf Haus- und Stalldächer um Blitzschlag und Viehseuchen vorzubeugen, während man in den Alpen bereits erkannt hatte, wogegen er wirklich nützlich ist. Dort behandelte man damit bereits Hautausschläge, Verbrennungen, Insektenstiche und kleine Wunden. Auch die leuchtend gelben Arnika-Blüten der Alpwiesen wurden bereits gegen allerlei Verletzungen, Prellungen, Schwellungen, Entzündungen und Schmerzen verwendet. Die Wirksamkeit dieser Pflanzen ist heute wissenschaftlich untersucht und bestätigt.

Moderne Wissenschaft und Folklore – ein Gegensatz?
Viele Jahrhunderte vergingen, bis sich die Arbeit der privilegierten Gelehrten der Städte zu moderner Wissenschaft und Medizin entwickelte. In Laboren entwickelt man heute synthetische Medikamente gegen Beschwerden, gegen welche die Alpenbewohner schon seit langer Zeit erfolgreich Pflanzen anwenden. Im Gegensatz zu pharmazeutischen Mitteln sogar ohne potenziell schädliche Nebenwirkungen. Die nützlichen Eigenschaften der Alpenpflanzen wurden zunächst per Zufall da entdeckt, wo man mit ihnen arbeitete. Wer sein Schlafzimmer mit Möbeln oder Wandvertäfelung aus Arvenholz einrichtete, bemerkte den herrlichen Duft des Holzes und dass er besser schlief. Schreiner, die hauptsächlich Lärchen verarbeiteten, hatten seltener Hautkrankheiten, Rheuma oder Atemwegserkrankungen, welche bei Schreinern durch Holzmehl eigentlich recht häufig vorkamen. Ein Tee aus Fichtennadeln hilft ebenfalls gegen rheumatische Beschwerden und dank Vitamin C und E gegen Erkältungen. Sogar für gesundes Haar erkannte man ihren Nutzen bereits früh. Das Harz der Tannen wirkt wärmend in Salben, hilft bei Muskelbeschwerden und fördert Wundheilung.
Eins der wichtigsten Werkzeuge des vorindustriellen Zeitalters war das Seil. Zur Herstellung benötigen die Seiler reichlich Hanf. Selbstverständlich war die Rauschwirkung damals bereits bekannt, aber Hanfprodukte und der Einsatz als Schmerzmittel waren so begehrt, dass ein Verbot in der Schweiz erst 1951, als sich Baumwolle bereits als Ersatz für Hanfprodukte etabliert hatte, durchgesetzt werden konnte. Heute dürfen THC-arme Hanfplanzen wieder angebaut werden. Sie sind immerhin noch reich an Omega-3, Omega-6, Vitamin E und Spurenelementen, sodass sie sich hervorragend zur Haut- und Haarpflege eignen.
Naturkunde als wichtigste Lebensgrundlage in den Alpen
In der Alpwirtschaft ist die Qualität der Pflanzen und des ökologischen Gleichgewichts die wichtigste Voraussetzung für ertragreiche Arbeit. Die Älpler mussten daher besonders gut die Pflanzen und das Wetter beobachten. Diese Tradition pflegen übrigens heute noch die berühmten Muotathaler Wetterschmöcker. Damit ein Käse wie der Walliser Raclette besonders gut schmeckt, brauchen die Kühe gesunde Weidegräser und Kräuter. Deren Pflege ist schließlich Aufgabe der Älpler. Nicht nur der Käse, sondern zuerst die Kühe profitieren davon. Sie werden seltener krank als Kühe in Großstallungen mit Silofutter und benötigen auch keine Medikamente um Krankheiten vorzubeugen. Im Winter, wenn die Kühe im Stall zu Tal untergebracht waren, hatten die Bauern oft große Not, sie zu versorgen. Wenn der Sommer zu viel Regen zum Heuen hatte, oder wenn der Winter sich so weit ins Frühjahr verlängerte, dass alle Heuvorräte aufgebraucht waren, mussten sie alternatives Futter besorgen. Flechten wachsen zuhauf an kahlen und abgestorbenen Bäumen, ein Merkmal für besonders gute Luftqualität. Sie erwiesen sich damals als wertvolles Notfutter und nebenbei noch als Hustenmittel. Wie die Flechten nur an reinster Luft wachsen, so sind auch andere Pflanzen wichtige Bioindikatoren. Knabenkräuter weisen auf feuchten Boden hin, wo man zwar kein Haus bauen sollte, der aber besonders fruchtbar ist und auch viele andere gesunde Pflanzen als Viehnahrung beheimatet.
Auf dieser Grundlage wuchs das ausgeprägte Naturbewusstsein der Alpenbewohner. Ohne ein gesundes Ökosystem kann man dort nicht leben. Man muss es schützen und pflegen, um nicht seine eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Das bedeutet, dass alles was man dem System entnimmt, äußerst wertvoll ist, und alles davon, was irgendeinen Nutzen hat, verwertet werden sollte. Das gilt nicht nur für Pflanzen, sondern auch für Tiere. Früher war die Jagd ein reines Mittel zur Nahrungsbeschaffung. Unkontrollierte Trophäenjagd und Jagdtourismus schädigten die Artenvielfalt enorm und rotteten sogar ganze Tierarten in den Alpen aus. Nur mit großer Mühe konnten manche Arten wie der Steinbock wieder angesiedelt werden. Inzwischen hatten andere Tierarten, wie Rotwild oder Murmeltiere, die Gelegenheit sich nahezu unkontrolliert zu vermehren, denn auch ihre natürlichen Feinde wurden durch Jagd ausgerottet. Das wiederum führt zu großen Schäden an Wäldern, die Talschaften vor Murgängen schützen und andere wichtigen Tierarten beherbergen, und Alpweiden. Deshalb muss ihr Bestand auch heute noch durch kontrollierte Jagd reguliert werden. Das heißt, die Behörden beobachten die Wildestände und geben eine streng begrenzte Zahl Tiere zu bestimmten Jahreszeiten zum Abschuss frei. Erlegte Gemsen und Hirsche bieten nicht nur köstliches Fleisch, sondern auch wertvolles Fett, dass schon im Mittelalter der Hautpflege diente. Es schützt und pflegt die Haut vor kaltem Wind, der sie austrocknet. Das Fett der Murmeltiere ist sogar noch viel wertvoller. In einem großen Kochtopf ausgelassen, steckt das gewonnene Öl voller gesunder Wirkstoffe gegen Muskel- und Gelenkbeschwerden, Arthrose, Reuma und Hautentzündungen. Die enthaltenen Corticoide wirken ähnlich wie Cortison, nur ohne die unangenehmen Nebenwirkungen.

Heilpflanzen – überlebenswichtige Alternative, wo medizinische Versorgung kaum vorhanden ist
Auch hier sieht man bereits am Einsatzgebiet der Tierfette und Pflanzen: Fast alle bekämpfen Beschwerden, unter denen die Menschen durch schwere, körperliche Arbeit und Witterung zu leiden hatten. Viele Kilometer am Tag bergauf und bergab im steilen Gelände ohne bequeme Wanderschuhe laufen zu müssen, dabei auch noch Vieh zu treiben, Wiesen zu mähen oder Baumstämme zu bewegen, das belastet Muskeln und Gelenke enorm. Allein der Gedanke daran lässt schon blutige Blasen an den Füßen aufplatzen. Bei Verletzungen einen Arzt aufzusuchen und sich krankschreiben lassen: unmöglich. Man musste sich selbst zu helfen wissen. Die Frauen sammelten Kräuter und Pflanzen, stellten Tinkturen und Salben her, kochten Tee und Suppen und wickelten Waden ein. Welches Kraut wogegen gewachsen war, wussten sie und wenn das gewünschte Kraut gerade nicht zu finden ist, dann hat gerade halt ein anderes Kraut Saison, dass ähnlich hilft.
- Johanniskraut ist vielseitig einsetzbar. Als Rotöl hilft es bei Sonnenbrand, Nackenverspannungen und Muskel- und Nervenschmerzen. Auch gegen Entzündungen soll es wirken und die Wundheilung fördern.
- Der Wallwurz wirkt entzündungs- und schmerzhemmend. Bei Prellungen, Hämatomen und Gelenkbeschwerden hilft er.
- Die ätherischen Öle des Rosmarin wirken wärmend, lockern verspannte Muskeln und regen den Kreislauf an. Auch rheumatische Beschwerden soll er lindern.
- Das Farnkraut ist eins der ältesten bekannten Mittel. Bei Wadenkrämpfen, Nervenschmerzen, Rheuma und Gicht wirkt es.
- Eichenrinde wirkt entzündungshemmend, gegen Juckreiz und schützt die Haut.
- Heublumen wirken ebenfalls entzündungshemmend, aber auch blutungsstillend und krampflösend.
- Die Ringelblume wird auch heute noch häufig in Kosmetika verwendet. Sie hilft der Haut, sich zu regenerieren, desinfiziert, bekämpft Entzündungen, Sonnenbrand und hilft bei Magen-Darm-Beschwerden.
Erkältungen sind in den Wintermonaten oft vorprogrammiert. Auch dagegen haben sich viele Pflanzen bewährt. Thymian wächst fast an jedem Berghang. Er wirkt schleimlösend und als Thymian-Öl auch gegen Mückenstiche. Die Wirkung von Minze und Eisenkraut gegen Atemwegsbeschwerden ist seit dem Mittelalter bekannt. Auch Propolis, aus Bienenwaben gewonnen, hilft bei Erkältungen.
Kräuter sammeln im Urlaub
Dies sind nur einige Beispiele für den vielfältigen Nutzen der Natur für den Menschen, der das Lesen so mancher Packungsbeilage und viele Risiken und Nebenwirkungen ersparen kann. Ihre Wirkungsweisen sind schließlich wissenschaftlich belegt. Doch bevor Sie im Urlaub auf Kräutersuche gehen, informieren Sie sich zur Sicherheit, ob die gesuchten Pflanzen im jeweiligen Kanton unter Naturschutz stehen! Vor allem durch den Klimawandel sind inzwischen einige Arten stark gefährdet und leider immer seltener zu treffen. In vielen Bergapotheken oder bei Kräuterkundigen Einheimischen erhalten Sie fertige Salben und Präparate aus regionalen Kräutern.