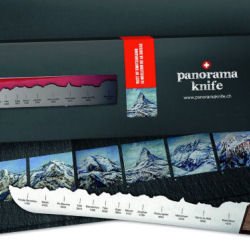Das Balzverhalten der Schweizer - Frühling nach alter Tradition

Der Winter zieht sich zurück und macht Platz für neues Leben: Bienen summen, Blumen blühen, Gräser sprießen und die Sonne steht länger am Himmel und wärmt die Herzen von Mensch und Tier. Die Hormone fahren Achterbahn, denn der Frühling ist die Zeit der Erneuerung und Fruchtbarkeit. Kein Wunder also, dass viele Frühlingsbräuche eng mit dem Umwerben einer Herzensdame verknüpft sind. Aus moderner Sicht der fortgeschrittenen Zivilisation werfen manche dieser Bräuche ein etwas fragwürdiges Licht auf das Balzverhalten der Schweizer Mannen. Trotzdem haben sich diese Bräuche auch in der modernen Schweiz erhalten können und tatsächlich entstehen daraus so manche, langjährige Partnerschaften und sogar Ehen. Vielleicht findet der ein oder andere Junggeselle darunter auch eine Inspiration, das Herz seiner Angebeteten zu erobern? Natürlich nur auf eigene Gefahr!
«Einmal abspritzen, Bitte!»
So heißt es zumindest im Kanton Graubünden, wo sich im Engadin ein alter, vorchristlicher Brauch erhalten hat. Im Schatten der hohen Berge, die oft noch bis in den Mai oder Juni verschneit sind, hält der Frühling meist erst etwas später Einzug. Während des «San Gian», dem Johannistag am 24. Juni, werden die Mädchen der Dörfer ordentlich nass. Bereits vor dem eigentlichen Festtag beginnen die Jungen der Gemeinden, aus Holz oder eisernen Rohrstücken – früher sogar aus alten Gewehren – ihre eigenen Wasserpistolen, die sogenannten «Squittaroulas», zu bauen. Im Morgengrauen füllen sie diese an den Brunnen der Dörfer auf und ziehen durch die Gassen. Ihre Ziele: junge, ledige Mädchen. Mit ihren selbstgebauten Wasserspritzen jagen sie den Damen hinterher und spritzen sie so lange nass, wie sie können. Aus Dankbarkeit für die gründliche Bewässerung schenken die Mädchen den Jungs am Abend Eier, das klassische Symbol der Fruchtbarkeit. Natürlich können sich die hormongeladenen Jugendlichen kaum zügeln, weshalb auch die Jungs am Ende des Tages ordentlich durchnässt sind. Eier verschenken jedoch nur die Mädchen.
Scheibenschlagen - Ein glühend heißes Spektakel
Ein weiterer faszinierender Frühlingsbrauch in Graubünden ist das «Schiibaschlaha», zu Deutsch «Scheibenschlagen». Die Vorbereitungen beginnen bereits nach Silvester. Junge Männer ziehen in die Wälder, um Bäume von etwa 15cm Stammdurchmesser zu fällen. Diese Bäume werden ins Dorf transportiert und dort in Werkstätten weiterverarbeitet. Mit großen Sägen werden die Stämme in gleichmäßige Stücke geteilt, mit der Axt in Scheibendicke gespalten und dann mittig durchbohrt. Die Ränder der Scheiben werden mit Sackmessern «uspätschgat», also abgerundet.
Am späten Abend des ersten Fasnachtssonntags beginnt das Spektakel. Auf verschiedenen Abschnitten eines Hügels, etwas abseits des Dorfes, sind Abschussrampen aufgebaut. In weißen Kitteln, den «Fuaterjuppa», mit Zipfelmützen, roten Tüchern und Fackeln ausgerüstet, ziehen die Scheibenschläger zu den verschiedenen Scheibenplätzen. Neben den Scheiben und den Fackeln werden auch Tabakwaren mitgenommen, schließlich gehört das Qualmen in dieser Nacht dazu. Die kleineren Jungen werden von ihren Vätern und Großvätern begleitet, sodass dieser Brauch zuverlässig von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Am Feuer werden die Scheiben auf Ruten gesteckt und zum Glühen gebracht. Mit kräftigen Schwüngen wird die leuchtende, glühende Scheibe von der Abschussrampe ins dunkle Tal geschleudert. Die Scheiben sind traditionell einem Mädchen gewidmet. Früher ausschließlich jenem, welches der Scheibenschläger begehrte, heutzutage kann jede Frau des Dorfes, sogar eine beliebte Lehrerin oder einfach die nette Verkäuferin vom Dorflädeli eine Widmung erhalten. Alle Damen sollen bedacht werden. Damit kein Mädchen vergessen wird, tragen alle Schläger zuvor ihre «Begünstigte» in eine Liste ein. Während des Scheibenschlagens rufen die jungen Männer einen Spruch hinunter in das Tal. Sie können sich beispielsweise dabei auch für die spätere Bewirtung bedanken: «Höut un dära sei si, dia Schiiba, dia Schiiba ghört dr alta Chüechlipfanna!» Wenn alle Scheiben verschossen sind, kehren die Scheibenschläger ins Dorf zurück, wo die Mädchen auf sie warten. In Gruppen gehen sie nun zu den Mädchen, denen sie die Scheiben gewidmet haben. Vor den Häusern bitten sie um frisch gebackene «Fasnachtsschüechli». Auch Orangen und Kaffee werden den Jungs als Dank überreicht. Dieser Brauch ist den Jugendlichen vorbehalten. Ältere, ledige Männer bleiben am Scheibenplatz zurück.




«Gäuerle» – Lehren aus dem Tierreich
Haben Sie schon einmal im Frühling die Vögel beobachtet? Unsere gefiederten Freunde unternehmen zu dieser Jahreszeit viel mehr, als den Weibchen ein Lied zu zwitschern. Um ihnen zu imponieren, werden die Männchen zu wahren Tänzern und Akrobaten. Die Männer im Kanton Schwyz tun es den Vögeli gleich und präsentieren ihre hohe Kunst der Balz beim «Gäuerle». Dabei tanzt das Schwyzer Männchen stampfend und klatschend um das begehrte Weibchen herum. Eine Ländlerkapelle mit Schwyzerörgeli und Bassgeige begleitet in der Regel dieses «Bödele». Damit das gewöhnliche «Bödele» zum imponierenden «Gäuerle» wird, springt er gelegentlich mit akrobatischen Verrenkungen in die Luft oder improvisiert Figuren, die dem Weibchen seine erstklassige körperliche Verfassung demonstrieren.
Der Ursprung dieses Tanzes ist nicht ganz geklärt, da er außerhalb von Schwyz nur vereinzelt getanzt wird und es nur wenige historische Quellen darüber gibt. Einige Experten, wie der Schwyzer Volkstänzer Röbi Kessler, vermuten jedoch, dass der Schwyzer Tanz eine Verbindung zum spanischen Flamenco hat. Andere wiederum sehen Ähnlichkeiten mit dem französischen «Gaillarde», bei dem der Mann um die Frau herum tanzt und dabei pfauenartige Sprünge vollführt. Diese pfauenartigen Bewegungen erinnern an das Balzverhalten des Auerhahns, eine mögliche Erklärung für die Herkunft dieses Brauchs.
Tschäggättä – Die hemmungslose Treibjagd
Nein, das ist kein Laut, den man beim Niesen erzeugt, sondern ein besonders kurioser und gruseliger Frühlingsbrauch: Vom 3. Februar bis Aschermittwoch ziehen mysteriöse Gestalten durch das Lötschental im Wallis. Mit weiten Sackhosen, Tierfellen, einer dicken Kuhglocke um den Bauch und grotesken, geschnitzten Dämonenmasken jagen die Tschäggättä Einwohnern und Skitouristen einen ordentlichen Schrecken ein. Wer sich von ihnen erwischen lässt, wird in den Schwizkasten genommen und mit Schnee eingerieben, oder gleich mit dem Gesicht vorran in den Schnee gedrückt. Doch was hat das Ganze mit Liebe zu tun?
Auch wenn der Ursprung dieses Brauchs nur schwer nachvollziehbar ist, lässt sich zumindest erklären, wie er sich in der Schweiz entwickelt hat. Früher waren es ausschließlich junge Männer, die sich hinter diesen unheimlichen Masken versteckten. Sie zogen durch das Tal und jagten die Frauen. Was heute als fragwürdig erscheint, war damals ein Brauch, der mit Balz und Liebeswerbung zu tun hatte. Die Junggesellen versuchten, ihre Herzensdame zu beeindrucken, indem sie mit diesem schaurigen Auftritt ihre Kraft demonstrierten.

Pschuuri – Der Schabernack geht weiter
Gruselige Gestalten sind keine Walliser Erfindung. Im Kanton Graubünden, in der Gemeinde Splügen, sind die nächsten Vermummten anzutreffen. Mit Lumpen, Fellen und Maskerade durchstreifen die monsterähnlichen Gestalten das Dorf auf der Jagd nach begehrten Damen. Die Gassen sind erfüllt vom Lärm der Glocken um ihren Bauch, einem Warnsignal für ihre Opfer. Sind die Glocken zu hören, sind die «Pschuurirolli» nicht mehr weit und die Flucht ist ratsam. Das wichtigste Symbol des Brauches: Eier! Hier erfahren Sie mehr darüber.