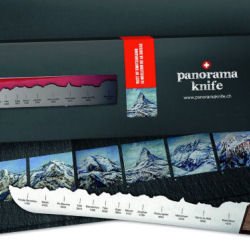Die glücklichen Kühe der Schweiz

Schweizer Käse und Schweizer Schokolade sind weltberühmt. Wäre frische Butter für den Export geeignet, dann wäre sie es mit Sicherheit auch. Zwar könnten diese zwei Köstlichkeiten unterschiedlicher nicht sein, aber eines verbindet sie: Der Schlüssel zum Erfolg von Raclette, Gruyère und zartschmelzender Schoggi liegt in der unglaublich guten Schweizer Kuhmilch. Die Kuh hat in der Schweiz einen ganz besonderen Stellenwert. Zahlreiche Bräuche wie der Alpaufzug und Alpabzug sind ihr gewidmet. In ländlichen Regionen ist sie im Landschaftsbild allgegenwärtig. Scheinbar gibt es mancherorts sogar mehr Kühe als Menschen. Rund 600.000 Kühe in der Obhut von rund 20.000 Milchbauern gibt es schätzungweise in der Schweiz. Jährlich geben diese bis zu 4 Milliarden Liter Milch. Der Milchsektor macht etwa ein Fünftel der gesamten landwirtschaftlichen Produktion aus. Was würde die Schweiz nur ohne ihre muhenden Freunde machen?
Vom Nutztier zur Werbeikone
Die Geschichte der Kühe in der Schweiz geht bis in die Steinzeit zurück. Schon damals domestizierten die Leute im Gebiet der heutigen Schweiz Kühe für die Selbstversorgung. Kuhmilch und Rindfleisch waren schon damals Grundnahrungsmittel der Alpenbewohner. In der Antike, als die Römer die heutige Schweiz besiedelten, revolutionierten sie mit ihrem Wissen die Viehhaltung. Bauern pflegten erstmals ganze Herden und das Fleisch wurde auf Märkten verkauft. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches, während Ländereien schwer umkämpft und Weiden selten waren, waren Schweine das bevorzugte Nutzvieh. Nur wenigen Bauern war es noch möglich, einige Rinder zu halten. Erst als die Bevölkerungszahlen anstiegen und die neuen Grenzen halbwegs geklärt waren, lohnte sich die Rinderhaltung wieder. Während des Mittelalters wurden die Rinderhaltung und die Milchproduktion zu einem der wichtigsten Sektoren der Landwirtschaft. Besonders Klöster widmeten sich der Produktion von Milchprodukten. Im Spätmittelalter breiteten sich Käsereien in der ganzen Schweiz aus, die nun die Klöster mit Käse versorgen mussten. Auch der Export über die Alpenpässe wie den Gotthard erwies sich als sehr lukratives Geschäft. Schon damals wurde der Schweizer Käse bis über die Landesgrenzen hinaus für seine Qualität sehr geschätzt.
Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert machte auch vor der Milchindustrie nicht Halt. Effizientere Transportwege beflügelten auch die Produktion und den Handel. Bauern schlossen sich in Milchgenossenschaften zusammen, um die Produktion zu sichern und zu maximieren. Selbst die Kuh musste effizienter werden und neue Milchkuhrassen wurden gezüchtet. Heute ist der Röstigraben nicht nur eine Sprachgrenze, sondern gewissermaßen auch eine Art «Kuhgrenze». Während im Westen vorwiegend Braunvieh zum Einsatz kommt, setzt man östlich des Röstigrabens meist auf Fleckvieh. Nach den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts wurde die Milchindustrie sogar staatlich gefördert, um die Versorgung zu sichern und die Technologien zu fördern. Die Schweizer Milchindustrie wurde so zu einer der qualitativ hochwertigsten der Welt und die Kuh zur Werbeikone und zum Symbol der Nation. Wer kennt nicht die lila Kuh?

Glückliche Kuh - gute Milch!
Nachhaltigkeit und Tierwohl liegen heute im Fokus und das nicht nur zum Erhalt der Produktqualität. Auch Verbraucher achten immer mehr darauf, dass die Milchprodukte ökologisch und biologisch gut hergestellt wurden, worauf sich die Bauern einstellen. Trotz der guten Qualität der Schweizer Milch spürt man auch den internationalen Druck durch Preise und Konkurrenz, doch dem wirkt die Schweiz mit subventionierten Bio-Programmen entgegen. Schließlich sind Schweizer Milchprodukte wegen ihrer Qualität so gefragt und die hat eben ihren Preis. Ohne glückliche Kühe gibt es keine gute Milch.
Kaum irgendwoanders auf der Welt sind die Standards für die Rinderhaltung so hoch. Sogar die Lebenserwartung der Kuh ist in der Schweiz deutlich höher. Viel Bewegung, frische Luft und gesunde Alpengräser zahlen sich eben aus. Auch die durchschnittliche Anzahl der Kühe pro Betrieb liegt bei gerade einmal knapp über 20. Im Vergleich dazu steht Deutschland mit über 70 Kühen pro Betrieb ziemlich schlecht da. Weniger Rinder pro Stall bedeutet auch eine drastisch reduzierte Notwendigkeit von Medikamenten und somit auch für den Menschen gesündere Produkte. Das RAUS-Programm sichert den Auslauf der Tiere. Obwohl die Teilnahme der Betriebe freiwillig ist, nehmen rund 90% der Schweizer Betriebe daran teil. Auch der Kuhstall wird mit einem eigenen Programm reglementiert. Das BTS-Programm («Besonders Tierfreundliche Stallhaltungssysteme») regelt, wie Liegeplätze eingestreut werden, dass Kühe Zugang zum Tageslicht haben und ein Liegebereich rund um die Uhr zugänglich ist. Auch dieses Programm ist freiwillig, aber die Mehrheit der Schweizer Bauern macht mit. All diese Mühen um das Wohl der Kühe zahlen sich aus und das schmeckt man auch.
Kuh-Kultur
Zahlreiche Events für und mit Kühen locken von Frühjahr bis Herbst tausende Besucher an und preisen wertschätzend die wertvollen, aber auch eigensinnigen Wiederkäuer: Die Alpaufzüge und Alpabzüge mit festlich geschmückten Kühen, Chästeilete, Viehschauen oder die berühmten Ringkämpfe der Eringer-Kühe im Wallis. Eine besondere Wesenseigenschaft der muskulösen aber recht kleinen Eringer ist es, dass sie innerhalb der Herde ihre Rangordnung ausfechten. Eine Kuh fordert die andere heraus, beide stehen sich drohend gegenüber und stoßen schließlich ihre Köpfe gegeneinander bis eine der beiden aufgibt und sich respektvoll zurückzieht. Das passiert auch bei den Ringkämpfen. Die Züchter bringen ihre stärkste Kuh in die Arena und warten ab, welche Kampfpaarungen sich ergeben. Wenn eine Kuh die Herausforderung der anderen nicht annimmt, oder eine Kuh erst gar keine andere herausfordert, dann kämpft sie halt nicht. Die Kuh hingegen, die alle anderen kampfeswilligen Kontrahentinnen besiegt hat, gewinnt das Turnier. Volksmusik und Raclette gehören traditionell zum Rahmenprogramm. Verletzungen sind zwar selten, aber durch die imposanten Hörner der Kühe nicht ausgeschlossen. Für diesen Fall beaufsichtigen Tierärzte die Kämpfe, um gegebenenfalls eingreifen und rasch behandeln zu können. Das Wohl der Tiere hat oberste Priorität!



Wenn Sie noch keines dieser Events besucht haben, schauen Sie vorbei. Es wird sich lohnen! Wenn Sie lieber auf einer Alpweide bei einer Wanderung persönlich Bekanntschaft mit diesen wundervollen Tieren machen wollen, haben Sie keine Angst. Beobachten Sie zunächst, ob Kälber auf der Weide sind. Sollte das der Fall sein, machen Sie sicherheitshalber einen großen Bogen um die Weide, anstatt sie zu queren. Mutterkühe verteidigen ihre Kälber gegen Eindringlinge jeder Art. Nur die ihnen bekannten Sennen sind auf der Weide gestattet. Sollten keine Kälber dabei sein, können Sie sich ihnen ruhig vorsichtig nähern und an Ihrer Hand schnuppern lassen. Das tun sie am liebsten ganz zärtlich mit ihrer Zunge. Wenn sie Ihnen dann wohlgesonnen ist, können Sie sie auch ein wenig kraulen. Musik mögen Kühe übrigens auch sehr gerne. Sie sind ausgesprochen neugierig und wollen alles entdecken. Beim kleinsten Misstrauen treten sie jedoch eher die Flucht an. Sollten Sie zufälligerweise etwas rotes tragen, seien Sie unbesorgt: Kühe können Rot schlecht erkennen und werden deshalb auch nicht durch die Farbe gereizt!